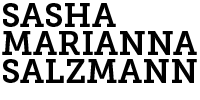Wo ich herkomme
10 Jahre Junges Schauspiel Hannover
Liebe Barbara,
immer wenn man mich fragt, wo ich herkomme – und man fragt mich, man fragt mich immer noch – weiß ich, was ich sagen muss: Ich komme aus dem Theater. Das war nicht immer so, erst seit kurzem habe ich das Selbstbewusstsein, diese Frage ohne zu zögern zu beantworten. Ungeachtet dessen, was die fragende Person als Antwort erwartet, sage ich die Wahrheit, sie ist einfach, sie kommt mir leicht über die Lippen und hat viel mit dir zu tun. Mit dir, dem Jungen Schauspielhaus Hannover, unseren Workshops in den Schulen, deinem mit Postkarten vollgeklebten Büro in der Intendanzetage in der Prinzenstraße, dem kleinen Vorraum, in dem ich meine ersten Telefonate auf Deutsch tätigte, mit schweißnassen Händen in den Hörer verkrallt, auf die Tischplatte starrend, wartend, dass mich am anderen Ende Menschen darauf hinweisen, dass sie (a.) kein Interesse an dem Schultheaterprojekt haben, das ich beauftragt war, für dich zu koordinieren; und (b.) mein Deutsch nicht verstehen. Beides trat nicht ein. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, als Hochstaplerin ertappt worden zu sein. Die Hochstaplerin, als die ich mich fühlte. Ich kannte das Wort „Hochstaplerin“ damals nicht, aber das Gefühl, sich in etwas Großartiges reingemogelt zu haben, wofür ich nicht die geringsten Qualifikationen mitbringe, kannte ich schon sehr früh. Ich hatte kein Abi, ich hatte keine Vorstellung von dem, was mein Leben sein könnte. Ich hatte fest vor, nicht älter als dreißig zu werden und bis dahin eine Boxerinnenkarriere hinzulegen. Ich war nicht schlecht – mein Trainer im Kenpokan Boxer Club bildete mich gerade für die ersten Kämpfe aus.
Nach diesem ersten Schulpraktikum, das ich bei dir 2001 absolvierte, brach ich die Schule ab – keine Sorge, das war nicht deine Schuld –, ich verließ das Gymnasium Bad Nenndorf und verkündete meinen Eltern schulterzuckend, ich will etwas anderes als das, was sie sich für mich vorgestellt haben, als sie in dieses Land gekommen waren: Ich werde keine Ärztin, keine Anwältin, gehe nicht in die Wirtschaft, mache nicht das, was man in meiner Muttersprache salopp mit „Business“ beschreibt. Ich zog nach Hannover, um auf dem Bürgersteig mit anderen Gleichgesinnten über Filme zu sprechen, wir haben gekifft, Cola und Chips von Aldi in uns reingestopft, meine Haare waren orange und reichten mir bis zur Hüfte. Alles schien möglich und gleichzeitig unendlich schwer. Es war toll. An einem solchen Nachmittag riefst du an. Ich saß auf dem Boden im Bahnhofsgebäude, bei Gleis 9, ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe, als du mich einludst, eine Hospitanz am Schauspielhaus zu machen. Das war so eine Zeit, in der ich nicht viel nachdachte, nicht viel plante, das glaube ich heute zumindest. Wenn ich zurückschaue, finde ich die Erinnerungsbilder von mir unbeschwert, obwohl mich im Inneren bestimmt die Schwerkraft der Pubertät zermalmte. Aber von außen betrachtet, sah man einen jungen Möchtegern-Hippi-Punk, der im Schneiderzeitz auf dem Boden einer Bahnhofshalle sitzt, sein Mobiltelefon aus der mit einer Küchenschere zerschlitzten Jeans rauszieht und den Anruf entgegennimmt, an den er sich sein ganzes Leben lang erinnern wird. Bei all den Schritten, die danach kamen, all den Stationen meiner Theaterlaufbahn, denke ich mindestens einmal an diesen Anruf, als du mich, mit deiner bestimmten und irgendwie auch immer schalkhaften Stimme fragtest, ob ich bei einer Theaterproduktion hospitieren würde. Ihr am Schauspielhaus brauchtet jemanden und du dachtest an mich, weil du mich als Praktikantin nicht schlecht gefunden hattest. Im Nachhinein betrachtet, könnte man fragen, was daran so groß ist: Eine Produktion braucht eine Regiehospitantin, sie rufen an, es ist ein unbezahlter Job, es ist nicht schwer, ihn zu machen. Aber für mich war es das Zeichen, dass jemand mir etwas zutraut. Und das ist, mit siebzehn, ohne Abi, ohne Pläne für irgendeine Form von „Business“, ziemlich viel. Ich hatte damals kein Smartphone und konnte nicht auf dem Handy googlen, was eine Hospitanz eigentlich ist. Ich hatte keine Ahnung, was du von mir wolltest. Ich hatte keine Ahnung, wer Sebastian Nübling, Bruno Cathomas oder Händl Klaus sind. Ich wusste nicht, ob das Superstars der Szene sind, oder ob es sich um eine Studentenproduktion handelt, zu der ich sofort zusagte. Ich wusste nicht einmal, wie man Kaffee kocht. Ich lernte. Ich lernte: Texte kopieren, bei Proben mitschreiben, Theater denken. Ich schrieb meine ersten Dialoge, kritzelte sie auf die Rückseiten von Händl Klaus´ Text. Zu meiner täglichen Beschäftigung gehörte, alles aufzusaugen, was um mich herum geschah, und unbedingt ein Teil davon sein zu wollen. Obwohl ich in der Schule ein notorischer Zuspätkommer war, war ich nun die Erste auf der Probebühne, saß in den runden Fenstern oben in dem Raum, der damals die Probebühne 1 war und heute die Spielstätte der Cumberlandschen Galerie, in der mein Stück „Aristokraten“ letztes Jahr Premiere hatte. Ich saß in den Fenstern wie in Kabinenluken eines Schiffs, mit den Füßen – wie es sich für Teenager gehört – gegen den Rahmen gestemmt und wartete, bis Bruno Cathomas kam, der mich „Kishinöw“ nannte, weil ich die Einzige in dem Raum war, die die osteuropäischen Namen in Klaus´ Stück „Wilde oder der Mann mit den traurigen Augen“ korrekt aussprechen konnte. „Kinshinöw, bist du da? Kishinöw, alles gut bei dir?“ Und wie! Ich hatte mit Sicherheit die beste Zeit meines bisherigen Lebens. Durch die katakombenartigen Gänge des Theaters zu irren, mich am Schneidetisch in der Grafik fast um eine Fingerkuppe zu bringen, vor einem kleinen Fernseher mit der gesamten Produktion zu sitzen und „Funny Games“ von Michael Haneke zu schauen und dann nach Hause zu gehen, um „Funny Games“ noch mal zu schauen und noch mal und noch mal und zu verstehen versuchen. Nicht mehr Tarantino zu schauen, sondern von Trier. Nicht mehr die Konkret zu lesen, sondern Theatertexte. Eine Kollegin drückte mir Sarah Kanes Stückeband in die Hände und sagte, sie glaube, das sei was für mich. Ich las alle fünf in dem Band enthaltenen Stücke in einer Nacht durch. Ich weiß noch, wie ich zusammengekauert auf meinem Bett saß, zitterte, meine Augen weit aufgerissen, sie fühlten sich lidlos an. Ich dachte, ich werde sie nie wieder schließen können. Gefühle, die in der Pubertät so unbedingt sind. Plötzlich hatte ich es ganz klar vor Augen, was ich wollte: Ich wollte das. Ich wollte schreiben. Ich wollte Sarah Kane. Ich wollte die Probenräume. Ich wollte Sebastian Nüblings Art, zu inszenieren, weil er in seiner Sonnenbrille und mit der Kommunistenkappe dasaß (er trägt sie immer noch, ich kenne Sebastian nun seit sechzehn Jahren und sehe ihn stets in derselben Uniform: Jogginghose, Sonnenbrille, Kommunistenkappe); er war der Coolste. Und alle waren genauso unnormal, bescheuert, heute würde ich sagen „queer“, wie ich. Als ich mich endlich getraut habe, dir die Dialogskizzen zu zeigen, die ich in Sebastian Nüblings Proben gekritzelt hatte, sagtest du: Wir schicken sie ein. Zu Kurzstückwettbewerben. So kam es zu meinem ersten Preis: Ein Kurztheaterstück von mir wurde ausgezeichnet, ich war immer noch siebzehn. Und ich war immer noch fest davon überzeugt, dass ich ein Hochstapler bin.
Zu deiner Unterstützung gehörte auch immer Kritik, harte Anmerkungen wie: „Du schreibst wie Thomas Mann. Wie wäre es, wenn du mal so schreibst, wie du schreiben möchtest?“ Ich weiß nicht mehr, ob ich es als eine Beleidigung oder als Kompliment aufgefasst hatte, ich weiß nicht, ob ich verstanden hatte, was du mir sagen wolltest. Und ich weiß nicht, ob dir damals klar war, dass der Halbwüchsige, der vor dir stand, in den Knochen die Angst trug, entlarvt zu werden, als jemand, der gar kein Deutsch kann. Der nicht in seiner Sprache schreibt, der immer noch auf Russisch Flucht, wenn ihm etwas auf den Fuß fällt, der so oft in der Schule gehört hat, dass er in einer falschen Welt gelandet sei, in die er nicht gehört und von der er nichts zu erwarten hat, bis er die Schule abgebrochen hat. Ich weiß nicht, ob ich dir je erzählt habe, dass ich beschlossen hatte, das Gymnasium zu schmeißen, weil die Beurteilung meiner Hausarbeit über die Französischen Revolution (im Fach Geschichte, das ich so sehr liebte) mit dem Satz begann: „Man merkt, dass die Autorin keine Muttersprachlerin ist …“ Dass mein Mathelehrer mir vor versammelter Klasse sagte: „Du musst gut in Mathe sein, du bist doch Jüdin.“ Und niemand aus dem Klassenverbund sagte etwas dagegen, niemand bot ihm Paroli, und ich warf mein Buch nach ihm, und er seins nach mir. Ich glaube, ich habe nicht viel erzählt von dem, was mir in den Unterrichtsräumen und auf den Schulhof widerfahren war, weil ich selbst nicht bereit war, es zu sehen. Ausgrenzung sickert in junge Körper unmittelbar ein, noch hat man keine Abwehrstrategien. Alles ist persönlich, alles ist ultimativ. Wenn es schlecht läuft, werden Erfahrungen wie solche zum Nährboden, auf dem man seine Persönlichkeit aufbaut. Auf Angst, Misstrauen, Fluchtinstinkten. Aber ich hatte Glück. Ich hatte Leute wie dich. Du gabst mir nie das Gefühl, ich würde das, was du von mir wolltest, vielleicht nicht können. Also konnte ich es. Als ich sechzehn war und gefühlt noch kein Deutsch konnte, gabst du mir eine Liste von Lehrer_innen, die ich abtelefonieren sollte, um Termine für Schulbesuche zu vereinbaren, und kümmertest dich nicht eine Sekunde um meinen Akzent oder um mein angsterfülltes Gesicht, das ich zu kontrollieren versuchte. Vor meinem Praktikum bei dir war jedes Telefonat, jeder Behördengang eine Qual, weil ich sicher war, man würde mich nicht verstehen. Obwohl ich heute glaube, dass mein Deutsch schon damals auf dem Niveau eines jeden lesenden deutschen Teenagers war. Du sagtest, ich kann schreiben. Aber ich soll schreiben, was und wie ich will. Ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was du meinst. Vielleicht bin ich immer noch in dem Prozess des Verstehens. Oder vielleicht bin ich durch meinen ersten Roman nun endlich dem Nahe gekommen, was Schreiben alles sein könnte. Was es bedeutet, eine eigene Stimme zu entwickeln und sie zu nutzen.
Das ist etwas, wofür du so vielen den Boden bereitet hast. Du vermittelst diese eine Möglichkeit, man selbst sein zu dürfen. In der Pubertät, noch bevor man sagen kann, „schaut, das ist mein Leben!“ – man wohnt noch bei den Eltern, man lebt mit ihren Erwartungen –, vermitteltest du uns das Gefühl, herausfinden zu dürfen, wer wir sein wollen. Wir dürfen rebellieren, und das ist ein Teil des Prozesses. Wir dürfen zweifeln, das ist ein Teil des Seins. Und du hast nie runtergespielt, wie schwer der Weg der Selbstfindung ist. Du hast uns nie angelogen. Als ich sagte, ich will Regie studieren, stelltest du mir Nurkan Erpulat vor, der bei dir am Schauspielhaus Hannover gerade „Heimat im Kopf“ inszenierte. Nurkan war der erste türkische Abgänger der Ernst Busch Hochschule in Berlin, und er berichtete mir von all dem Horror, den es bedeutet hatte, dieses Studium abzuschließen. Ich ging trotzdem zum Vorsprechen.
Ich zögerte lange, mich an der Universität der Künste für Szenisches Schreiben zu bewerben, weil ich dachte, das sei nicht für mich. Diese Institutionen sind für die, die nicht schon beim Anblick der Architektur des Uni Gebäudes erschrecken und denken: Die lassen mich da nicht rein. Und wenn, werden sie nach den ersten Wochen merken, dass ich ein Hochstapler bin. Das alles erwies sich im Nachhinein als Humbug, aber wie soll man das wissen als junger Mensch voller Ängste, zurückgewiesen zu werden? Andersrum: Was gibt es Ermutigenderes, als zu wissen, dass jede_r die Angst empfindet, abgewiesen zu werden? Dass es keinen Menschen gibt, der nicht von Zweifeln geplagt ist? Keinen, der nicht permanent darauf wartet, als Hochstapler enttarnt zu werden? Ich habe mit der Zeit begriffen, dass nur die wahren Hochstapler diese Angst nicht empfinden. Nur die Schamlosen sind zweifelsfrei.
Irgendwann gingst du vom Schauspielhaus Hannover an das Deutsche Theater Berlin und dann nach Düsseldorf und bekamst deine eigene Spielstätte. Du hast wie immer wahnsinnig gutes Theater gemacht – ich war ständig da, um es zu sehen. Die singende Stoffblume, die ich dir mal zum Geburtstag geschenkt hatte, ist immer mit dir umgezogen und stand in deinem Büro, hinter dir an der Wand, wuchs aus deiner Schulter, wenn du am Schreibtisch saßt. Du ludst Nurkan Erpulat und mich ein, auf der großen Bühne des Schauspielhauses Düsseldorf zu arbeiten. Da war ich schon Abgängerin der UdK, Stipendiatin der Akademie Tarabya in Istanbul und schrieb an meinem ersten Roman.
In Istanbul hatte ich eine vielsagende Begegnung, ich saß in einem Café in Karaköy und versuchte zu lesen, mich sprach ein junger Mann an, und als wir uns darauf verständigt hatten, dass ich ihn nicht heiraten will, unterhielten wir uns über Hannover – er kam auch von dort. „Barabara Kantel?!“, schrie er auf. Die Leute auf der Straße, in der wir saßen, drehte sich nach uns um. „Wallah, was sagst du, sie ist meine Theatermama, die hat alles aus mir gemacht, ich meine, die hat mich gemacht, wer ich bin!“ Murat ist heute Schauspieler am Theater und beim Film. Begegnungen und Gespräche wie diese kenne ich viele. Eine ganze Generation von Theatermacher_innen reagiert auf den Namen „Barbara Kantel“ wie auf „Kendrik Lamar“ oder vielleicht wie die vorherige Generation auf die „Beatles“ reagiert hat. Wir kreischen los. Du bist eingeschrieben in die Erinnerungen unserer kollektiven Pubertät. Du bist unsere Superheldin. Wir haben dich fiktionalisiert und abgespeichert als die, die cooles Theaterzeug mit uns gemacht hat. Was genau? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, wie du es angestellt hast, dass wir doch nicht Boxer_innen, Dealer_innen oder Bänker_innen geworden sind. Wir sind eine Generation von Theatermenschen, die selbstbewusst an sich selber zweifeln und Theater ermöglichen und Theater machen. Wir erfinden Theater weiter, weil du uns an den entscheidenden Punkten unserer Menschwerdung vermittelt hast, dass wir alles sein können, was wir wollen. Dass wir schreiben können, wie wir wollen. Dass die Sprache, die Bühne, unsere Körper uns gehören. Dass die Deutungshoheit über unsere Welt bei uns liegt.
Leute wie mich gibt es, weil es Leute wie dich gibt. Und das zu begreifen, prägt mich als Mensch. Du hast uns möglich gemacht. Darum macht mir heute so einen Spaß, Theater für andere möglich zu machen. Ich habe das Gefühl, ich werde, wenn andere werden. Das habe ich von dir. Aus der Praxis. Du hast nie gepredigt, du hast uns nie gesagt, wie es sein sollte. Aber du hast gefragt, du hast uns provoziert, herausgefordert, ermutigt. Und das im empfindlichsten aller Zustände, in der Pubertät.
Ich kenne dich nun seit siebzehn Jahren, Barbara, das ist mehr als die Hälfte meines Lebens, wir haben zusammen getrunken, geprobt, wir haben uns bestimmt schon mal in den Haaren gehabt, und wir drücken uns immer wieder auf Theaterpremieren gemeinsamer Freund_innen. Es wäre gelogen, zu sagen, dass wir uns immer noch so viel austauschen wie früher, aber eines sollst du wissen: Wenn man mich fragt, wo ich herkomme, denke ich an dich. Weil ich aus dem Theater komme und vorher von nirgendwoher kam.
Heute schreibe ich, wie ich will, und muss niemandem beweisen, dass ich wie Thomas Mann kann. Ehrlich gesagt, habe ich ihn nie besonders gemocht.
Und jetzt feiern wir 10 Jahre Junges Schauspielhaus, und du bist wieder da. Nach einer langen Odyssee, von der ich nicht alle Stationen kenne. Und ich bin wieder hier in Hannover, und so viele, die du möglich gemacht hast, feiern mit: Wera Mahne, die heute ihr Stück „Mädchen wie die“ zeigt, Jakob Nolte, Tobias Herzberg, Branco Janack, um ein paar zu nennen, und ich bin mir sicher, Murat schwirrt hier auch irgendwo rum. Wir feiern heute diese Spielstätte und was sie für unseren Werdegang bedeutet, und wir feiern dich, Barbara. Ich feiere vor allem dich.