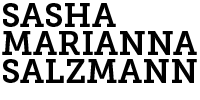What would Jimmy do
Den nächsten Sturm abwarten – F.A.Z., 1. März 2018
„Ich arbeitete an meinem ersten Roman – ich dachte, ich werde ihn nie zu Ende schreiben können – bis ich endlich verstand, dass einer der Gründe dafür war, dass ich mich dafür schämte, wo ich herkam und wo ich war. Ich schämte mich für das Leben in der Schwarzen Kirche, schämte mich meines Vaters, schämte mich des Blues (…) Ich verstand, dass ich mich begraben hatte unter dem kompletten Phantasma über mich, das nicht meins war, sondern das der weißen Leute.“ Der Roman, von dem hier die Rede ist, beendete und veröffentlichte James Baldwin 1953, da war er noch keine dreißig. Heute steht das Werk auf der Liste der 100 besten englischsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts (The Modern Library). In Deutschland erschien es erstmals 1966 unter dem Titel „Gehe hin und verkünde es vom Berge“ bei Rowohlt, und nun legt dtv eine Neuübersetzung von Miriam Mandelkow mit geändertem Titel vor: „Von dieser Welt“ portraitiert eine zerrissene Familie, die in ihrer Harlemer Kirche vor den Altar tritt, um gemeinsam zu beten. Bereits in seinem Debüt ist Baldwins Talent zu bestaunen, auch noch den letzten Winkel der menschlichen Seele auszuleuchten. Kompromisslos und beklemmend zeigt er, was seine Charaktere der lange Weg an den Altar gekostet hat. Zunächst glaubt man, den gerade vierzehn Jahre alt gewordenen John dabei zu begleiten, wie er durch das New York der fünfziger Jahre streunt und am Ende seines Spaziergangs damit hadert, dass er in seine strenggläubige Gemeinde, und damit auch in die Arme des gewalttätigen Vaters, zurückkehren soll. Doch bald schon findet man sich in einem Strom aus Familiengeschichten wieder, die über mehrere Generationen in den Süden der USA reichen. Die Anstrengung des jungen Autors, ehrlich mit seinem Stoff umzugehen, merkt man dem Roman nicht an, man liest ihn wie im Rausch. Aber man spürt den Schmerz, den es bedeutete, niederzuschreiben, was er zu sagen hatte. Benannt nach dem gleichnamigen Spiritual, ist „Go Tell It On The Mountain“ das Klagelied eines Mannes, der erst anfängt, sein literarisches und politisches Denken zu formen, und doch schon weiß, dass große Literatur nicht daher kommt, für jemanden Partei zu ergreifen. Bei Baldwin rettet sich niemand vor dem Fall.
Es ist kein Geheimnis, dass es ein semiautobiografisches Werk ist: Auch Baldwin war, wie sein junger Protagonist, ein uneheliches Kind und wuchs ohne leiblichen Vater auf. Seine Mutter kam mit dem dreijährigen „Jimmy“ 1927 aus dem Süden der USA nach New York und heiratete einen Reverend, mit dem sie weitere Kinder bekam, die James Arthur Baldwin großzuziehen half. New York steckte in dem, was wir heute „The Great Depression“ nennen. Die Familie hatte kaum Geld, der Stiefvater arbeitete in Fabriken, wenn er denn Arbeit bekam, die Mutter putzte die Häuser weißer Leute. „Jimmy“ war und blieb klein, schmächtig. In „Go Tell It On The Mountain“ erwähnt der Erzähler an mehreren Stellen, wie John immer wieder eingetrichtert wurde, dass er hässlich sei. Julius Lester schrieb in The New York Times Book Review, Baldwin sehe aus, als wäre er in Fleisch mehr gemeißelt, denn hineingeboren.
Mit dreiundzwanzig Jahren lebt James Baldwin bereits im Greenwich Village. Er arbeitet als Kellner und hat kein Geld fürs College, aber Freunde wie Beauford Delaney, der ihm, wie Baldwin es ausdrückt, „eine ungewöhnliche Tür öffnet“. Im „Village“ trifft er auf Marlon Brando, die Freundschaft hält ein Leben lang. 1968 werden sie Arm und Arm hinter dem Sarg von Martin Luther King marschieren.
dtv bewirbt die Neuübersetzung von „Go Tell It On The Mountain“ mit einem Zitat aus dem Time Magazin: „James Baldwin ist überall.“ Nun, wo überall? Auf den Plakaten der Menschenrechtsbewegungen, vor allem des Black Lives Matter in den USA. In den Kinos, die den Dokumentarfilm „I Am Not Your Negro“ in der Regie von Raoul Pecks zeigen. Hip Hop Superstars wie Jay Z und Beyoncé zitieren ihn in ihren Musikvideos. Der 2017 für seinen Film „Moonlight“ mit dem Oscar ausgezeichnete Regisseur Barry Jenkins arbeitet an der Kinoadaption von Baldwins „If Beale Street Could Talk“. Schon „Moonlight“ wirkt, mit seinem jungen schwarzen, schwulen Protagonisten, der nach Halt sucht in einer für ihn nicht geschaffenen Welt, wie eine Adaption eines von Baldwins Romanen.
Sicherlich ist die Behauptung nicht verkehrt, dass die wiederkehrende Prominenz James Baldwins viel mit der aktuellen politischen Situation in den USA zu tun hat: mit den race fights, den Polizeischikanen, dem neuen Präsidenten, dem Ta-Nehisi Coats in seiner Schrift „We were eight years in power“ nachweist, dass er der „erste weiße Präsident der USA“ ist, weil er gewählt wurde aus Hass und Ablehnung auf seinen schwarzen Vorgänger. Coats wird nachgesagt, er schreibe in der Tradition Baldwins. Viele tun es. Baldwins Dringlichkeit ist universell, seine Poesie Mut machend und verstörend zugleich. Er ist nie weg gewesen. Sein politisches Engagement machte ihn zu einer zentralen Figur der Menschenrechtsbewegung: Er diskutierte öffentlich Martin Luther King und Malcom X. Er schrieb unzählige Essays und Reden, die in international vielbeachteten Bänden wie „Notes of a Native Son“ oder „The Fire Next Time“ abgedruckt wurden. In seinen theoretischen Texten gelang es ihm stets, jene Zuschreibungen, mit denen die Weißen die Schwarzen etikettierten, an sein weißes Publikum zurückzureichen. Er beharrte darauf, kein Opfer zu sein. Der böse Schwarze Mann ist die Erfindung der Weißen, die aus Angst vor der eigenen Vergangenheit die Schwarzen verteufeln und aus der Gesellschaft ausschließen. Sich mit ihren Ängsten zu konfrontieren, ist die Arbeit, die sie zu leisten hätten, und ohne diese Arbeit gäbe es für sie keine Erlösung.
Aber Baldwin war kein Politiker, kein Stimmungsmacher. So wie der persische Dichter Ahmad Shamlou seine Gedichte nicht für die Transparente verfasste, die die Grüne Revolution im Iran durch die Straßen trug, so schrieb auch Baldwin nicht für Plakate. Er lehnte es bis zum Schluss ab, ein „spokesman“ zu sein, jemand anderen zu repräsentierten als sich selbst. Vielleicht war die größte Provokation an ihm, dass er für sich beanspruchte, das Konzept der Hautfarbe zurückzuweisen: „Es ist kein „Rassen-Problem“(…). Es scheint, die Amerikaner sind nicht in der Lage zu verstehen, dass ich Fleisch ihres Fleisches, Knochen ihrer Knochen, von ihnen selber geschaffen bin.“
Baldwin hält uns existenziell Menschliches vor Augen. Deshalb ist er auch keine historische Figur geworden, seine Gültigkeit und Aktualität sind permanent.
Meine erste Baldwin-Lektüre war keine, es war ein Hören. Ein Freund sprach mir „Giovannis Zimmer“ als Audiotake auf und schickte mir die einzelnen Kapitel, die ich bald täglich erwartete, an den Bosporus. Ich war damals nach Istanbul gezogen, der Freund sagte, Baldwin habe auch dort gelebt und vielleicht helfe mir das Buch ja bei meiner Suche – ich wusste selbst nicht wonach. Mein Freund sagte, „Giovannis Zimmer“ sei für ihn eine Navigation durch seine zahlreichen Coming Outs gewesen. Der Roman helfe bei der Verortung in der Welt. Istanbul spielt in dem 1956 erschienen Roman keine Rolle. Die Protogonisten des Romans bewegen sich durch die USA, durch Paris und die Provence. Sie sind männlich, weiß und verliebt. In den Bars, die Baldwin beschreibt, riecht es nach Schweiß. Die Seiten sind voll nervösem Lachen und abruptem Verstummen. Es geht um unerreichbare Väter und die ersten erotischen Erfahrungen der Kindheit, die Furcht und Ekel vor sich selbst auslösen. Es geht um das Nichtzulassenkönnen einer Liebe und um Verrat, der die verlassene Person aufs Schafott bringt. Ein Buch, von dem Baldwin sagte, wenn er es nicht geschrieben hätte, hätte er ganz zu schreiben aufgehört. Da war er noch immer am Anfang seiner Laufbahn. Nach „Von dieser Welt“ war „Giovannis Zimmer“ sein zweiter Roman. Man empfahl ihm, niemandem davon zu erzählen. Die expliziten Liebesszenen zwischen Männern würden ihm seine Karriere kosten. Er nahm das Manuskript mit nach England und veröffentlichte es dort. Bis heute ist „Giovannis Zimmer“ sein bekanntester Roman, zumindest in Deutschland. Der Roman, den man regulär kaufen konnte, während die anderen Werke antiquarisch bestellt werden mussten.
In dem legendären Interview für The Village Voice vom Juni 1984 fragt Richard Goldstein Baldwin nach der Notwendigkeit, offen über schwules Leben zu sprechen oder – was für Autoren synonym ist – zu schreiben. Baldwin erklärt in seiner Antwort, warum er sich nie als schwul bezeichnet hat. Schwul sei für ihn ein Verb. Etwas, was er tut. Er schläft mit Männern, ja. Aber das, was er ist, sei komplexer als das Wort „homosexuell“. Auch hier gibt Baldwin das Begehren nach Zuschreibung und Kategorisierung an sein Gegenüber zurück, insistiert auf das Unteilbare der menschlichen Existenz, lehnt die Fragmentierung des Individuums ab. Sagt jedoch sehr deutlich, dass die Verunsicherung über die eigene Sexualität seine Motivation wurde, zu schreiben. Alles sei damals unklar gewesen in seinem Leben, aber „diese Sache“ mit Sicherheit die am meisten quälende, die gefährlichste. Auf die Nachfrage, warum, gibt er schlicht zurück: „Weil es mir so eine Angst einjagte.“ Hier ist sie wieder, die Scham, die Angst. Baldwin benutzt sie, so wie alle Großen, in seinem Schreiben als Skalpell.
Meine zweite Baldwin-Lektüre am Bosporus war „Another Country“ (zu Deutsch momentan noch in der Rowohlt-Übersetzung „Eine andere Welt“). Gut hundert Seiten streunt der junge Rufus durch die Nacht, halb wahnsinnig, ängstlich, erbettelt sich in Bars Essen von Männern und stürzt sich dann von der Brooklyn Bridge. Bis heute ist für mich der Spaziergang über die Brücke zwischen Manhattan und Brooklyn ein Rufus walk, ein Gedenken an einen Freund, der das existenzielle Gefühl, nie wieder nach Hause gehen zu können, zur letzten Konsequenz brachte. Neben Rufus´ Geschichte erzählt „Another Country“ von einem Freundeskreis von Autoren, Schauspielern und Strolchen in New York. Ich las das Buch in einem Zug, und als ich die letzte Seite aufschlug, sah ich die Datierung und den Ort unter dem letzten Absatz: 1962, Istanbul. Mein Blick huschte zunächst darüber hinweg, ich brauchte Minuten, um zu verstehen, dass Baldwin den Roman in der Stadt beendet hatte, in der ich mich gerade befand. Istanbul. Er ist hier gewesen. James Baldwin ist überall. Wo?
In „James Baldwin´s Turkish Decade: Erotics of Exile“ portraitiert Magdalena J. Zaborowska eindrucksvoll die Zeit des großen Schriftstellers am Bosporus. Fotografien, Interviews und Zeitzeugenberichte veranschaulichen Baldwins Begegnungen mit der Türkei. Aber besonders intensiv ist jenes Gefühl nachvollziehbar, das Baldwin damals umtrieb: das Gefühl des Exils. Baldwin hatte die USA verlassen, in denen er in den sechziger Jahren bereits zum Gesicht der Schwarzen Bewegung avanciert war. Jenem „spokesman“, der er nie sein wollte. Die Hälfte seines Lebens schrieb er in der Diaspora, zunächst in Frankreich, dann in der Türkei. In Istanbul durch die Straßen flanierend, sagt Baldwin in dem von Sedat Parkay gedrehten Kurzdokumentarfilm „From another Place“: „Jeder Dichter ist gefangen in einer prä-revolutionären Situation (…) und muss herausfinden, welche Rolle er spielen will (…). Wir müssen da sein, wenn der Sturm vorbei ist und den nächsten Sturm abwarten. (…) Sturm kommt immer.“ Das wurde zu meiner Maxime. Ich schrieb diese Sätze an Tafeln in Unterrichtsräumen, in denen ich The Private Is Political unterrichtete. Ich schickte das Zitat an alle meine Freundinnen, nachdem Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt worden war. Und schob den Zusatz hinterher, mehr zu mir selbst, wir wissen, was zu tun ist: Schreiben. Schaffen. Wir sind Chronisten. Das ist Baldwins Formulierung. Er verwendet sie in mehreren Essays, setzt sie in all seinen poetischen Schriften um. In The Artist Struggle for Integrity schlägt er vor, über Dichter als diejenigen nachzudenken, die als Einzige die Wahrheit über die Gesellschaft kennen, in der sie leben. „Nicht Staatsmänner. Nicht Priester. Nicht Gewerkschaftsführer. Nur Dichter.“ Dichtung schreibt Identität, individuelle wie kollektive. Wir wissen voneinander, weil es Bücher gibt, die unsere Geschichten weitertragen.
James Baldwin ist überall und gehört zu uns und unserem Denken, nicht weil wir in politisch brisanten Zeiten leben, sondern weil die Welt immer nach ehrlicher, kompromissloser Literatur hungert. Sie dreht sich nicht ohne sie.