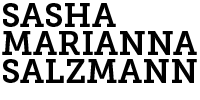_____ Laudatio _____ auf Nan Goldin
The Nan Goldin Gaze: Laudatio anlässlich des Kunstpreises Ruth Baumgarte
Liebe Nan Goldin,
liebes Hannover, es bedeutet mir viel, ausgerechnet hier über Nan Goldin und ihre Arbeit sprechen zu können, denn in dieser Stadt, in der ich aufgewachsen bin, entdeckte ich ihre Fotografien als Postkarten in Galerien und pinnte sie in meiner ersten Wohnung in der List an die Wand. Ich bin nicht mit Fotografie aufgewachsen, bildende Kunst war in meiner Kindheit sowjetische Kunst. Korrekt abgebildete Körper, die mit machtvoller Geste das Richtige tun. Aus unantastbarer Perspektive. Denkbar konträr dazu scheint mir Nan Goldins Werk zu sein und alles, wofür sie steht. Ich müsste spekulieren, was es für mich damals mit sechzehn bedeutet hat, Nan Goldins Postkarten an die Wand zu kleben und sie mit dem eigenen Leben zu verbinden. Damals wusste ich nicht, dass die Fotografin eine lebende Legende war, ich wusste nichts von bildender Kunst, ich war ein Teenager, der nach Halt suchte und ihn unter anderem im eifrigen Bekleben seiner Wände fand. Ich war mitten im Knochenwachstum begriffen, alles tat mir weh. Und Nan Goldins Fotografien beschrieben am besten, was ich empfand. Die ungeheure suggestive Kraft, die von ihnen ausgeht, hatte für mich damals eine heilsame Wirkung – mit sechzehn freilich hatte ich dafür noch keine Worte –, und so machte ich mir einen Spaß daraus, all die Postkarten mit Suzanne, Trixie, Cookie, Butch und Jane wie kleine Spiegelflächen an den unmöglichsten Orten zu verteilen. Wusste ich, dass all diese Fotografien demselben Bildband, Ballad of Sexual Dependency, entnommen waren? Natürlich nicht.
Viele hausten damals in meiner kleinen Wohnung in der List, auch wenn ich sie allein gemietet hatte. Manchmal wachte ich morgens auf und wusste nicht, wem ich im Flur, Bad oder Nebenzimmer begegnen würde. Meine Freund_innen, mein tribe, wie es Nan Goldin nennen würde, formierte sich damals schon aus jenen, die den vorgegebenen Parametern, wie man zu leben habe, nicht folgen konnten. Oder wollten. Wir feierten, nahmen Drogen, und erst Jahre später, während meiner intensiveren Auseinandersetzung mit Nan Goldins Werk, begriff ich, dass sie damals immer dabei gewesen war.
Heute versuche ich zu verstehen, wie und wodurch mich ihre Fotos in der Welt verorteten und dadurch heilten. Ich versuche zu verstehen, warum mir ihr I want the people in my pictures to stare back stets Hoffnung machte. Mir das Gefühl nahm, bloßes Objekt zu sein, auf das der wertende Blick der Dominanzgesellschaft fällt.
In den Orten, die Nan Goldin für ihre Ausstellungen wählt, scheint bereits ein erster Schlüssel verborgen: Von den New Yorker Bars in den 70er Jahren, in denen sie ihre Bilder, mit Musik unterlegt, als Slideshows ihrer Community präsentierte, bis zu ihrer aktuellen Ausstellung in der Kanalisation von Versailles spannt sich eine Kette. Es ist sprechend für das gesamte Werk dieser Fotografin, dass ihr ausgerechnet das System von Röhren und Schächten unter dem Schloss des Sonnenkönigs die Inspiration für ihre site-specific Arbeit liefert. Nan Goldin erhielt den Auftrag für eine Ausstellung in einer der größten Palast-Anlagen Europas – und sie geht in den Untergrund. Ihr Interesse, ihr Blick galt dem Marsch der Poissarden auf die Residenz des Königs 1789, jenem Protestmarsch tausender Zivilisten, darunter mehrere hundert Marktfrauen, die schließlich den Herrscher zwangen, Versailles zu verlassen. Die Künstlerin suchte nach einer geeigneten Umgebung, um diesem Ereignis den gebührenden Platz zu geben. In ihrem Text The Women´s March, 1789 entstanden für den Katalog zu dieser Ausstellung, erklärt sie: As usual, I wanted to go underground to see what is hidden, und die mit ihr zusammenarbeitende Architektin Hala Wardé kommentiert: wir hatten Nan Goldin verloren, und wir fanden sie wieder im Keller, wo sie sich wohler fühlte.
Diese zwei Katalogbeiträge beschreiben beides: die Bewegungen, die Nan Goldin vollzieht, und unseren Blick auf sie und ihre Arbeit. Wir wissen nicht, was wir zu erwarten haben, aber wir wissen, der Blick der Fotografin wird uns unter die Oberflächen dessen führen, was wir glauben zu sehen. Fassaden haben sie nie interessiert. Der fragende Blick hinter die Kulissen zeichnet ihre Arbeit seit den späten 70er Jahren aus.
Nan Goldin fotografierte Junkies, Drag Queens, HIV-Positive; Leute die wir heute Queers nennen, waren die Protagonistinnen ihrer Heldinnengeschichten. Goldin wollte für Modezeitschriften arbeiten, doch statt nach konventionellen Modellen zu suchen, überschrieb sie die verführerischen Posen der Modefotografie mit jenen Körpern, die der Norm per Definition widersprachen. So entwickelte sie ihren kämpferischen Stil. Sie erkundete die Innenseite von Menschen, die in den Balls in New York in die Rollen von Madonna und der Queen schlüpften und auf der Straße um ihr Leben rannten. Die zum Gelderwerb ihren Körper verkauften, die AIDS zum Opfer fielen, die in den race fights untergingen, die die Menschenrechtsbewegung in den USA vorantrieben. Aber sie suchte nicht nach ihnen, sie stellte sie nicht als Aussätzige, als die anderen, vor die Kamera. Das Gegenteil ist der Fall: Sie portraitierte ihre Familie, ihren tribe. In einem Interview erzählt sie, dass sie davon besessen war, die Menschen, die ihr nah waren, zu fotografieren, in der Überzeugung, so blieben sie für immer bei ihr. Sie musste genau hinschauen, sie kam den Leuten zu nah. Sie nahm ihre Kamera mit, wenn sie mit ihren Geliebten duschte. Sie stand mit am Bett der HIV-kranken Freund_innen und drückte auf den Auslöser, wenn deren Partner_innen sich über die ausgezehrten Körper beugten. Sie nennt ihre Bilderserien family snapshots. Natürlich haben sie nichts von privaten Schnappschüssen, aber es ist die Involviertheit der Fotografin, die diese Bilder für uns so bezwingend persönlich macht. Aus einer solch involvierten Perspektive ist kein Voyeurismus möglich.
Nan Goldin war und bleibt die Störung. Sie kam als Veto in eine Welt, in der Kunst dazu neigte, Körper zu idealisieren, bis sie kein vergängliches Fleisch mehr besaßen und keine Gerüche mehr verströmten. Goldin hingegen konfrontiert uns mit Verwundeten und nimmt uns die Illusion, unbeteiligt zu sein. Jene, die wir vorher als die anderen eingeordnet haben, die wir die Marginalisierten nannten, sind nun unsere Realität. Sie sind Menschen wie wir, wir sehen ihren Alltag. Wir sehen, dass sie so leben wie alle anderen auch – sie setzen Kaffee auf, schminken sich, eilen Alleen entlang, sterben. Sie gehen uns etwas an, weil sie sind wie wir, und darum objektivieren wir das abgebildete Geschehen nicht mehr, setzen es nicht mehr unserem wertenden Blick aus.
Nan Goldins Fotografien können Mahnwache sein, Starabbildung und Manifest. Doch keines ihrer Fotos eignet sich als Plakat für eine Menschenrechtsdemonstration, denn alle ihre Heldinnen haben Unrecht – so, denke ich, entkommt sie der Vereinnahmung. Die Guten gibt es nicht, und das Licht fällt unvorteilhaft auf die mit Scham behafteten Körper. Man sieht Gebrochene, Ekstatische, Sterbende, aber nie sind sie als Objekt ausgestellt. Genaugenommen sind sie keine Objekte. Denn auch wenn man Goldin selbst oft auf den Fotografien nicht sieht, glaubt man doch, in ihrem Körper zu stecken, während sie den Auslöser der Kamera betätigt. Man liegt mit ihr auf dem Hotelbett, während sie andere beim Sex fotografiert, der eigene Unterarm schmerzt vom Einstich der Nadel. Man fühlt ihre Arbeit, man empfindet die Emotion, die sie in ihren Fotos gegenwärtig macht.
Und etwas anderes sieht man nicht minder deutlich: Goldin fotografiert um ihr Leben. Sie hält sich an ihrer Kamera fest, um nicht abzustürzen. Die Wirkung, die ihr Werk auf die Betrachtende entfaltet, wird verstärkt durch das Risiko, das die Autorin mit jedem Schuss auf sich zu nehmen scheint. Jedes ihrer Bilder sagt: Hier fotografiert eine, die in Gefahr ist. Sie teilt diesen Zustand mit uns: „Da! Seht, was hier geschieht.“
In ihrem Katalogtext zu der Ausstellung in Versailles schreibt Nan Goldin, ihre Arbeit sei ihr Aktivismus, but I am not making it into art. Die von ihr 2018 initiierte Gruppe P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now) hat sich dem Kampf gegen die die US-amerikanische Gesellschaft zersetzenden Opiate und gegen das Pharmaunternehmen der Familie Sackler verschrieben, die sie anklagt, die Schuld an über 400.000 Drogentoten zu tragen. Ihre öffentliche Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Abhängigkeit ist ihr Statement. Sie liefert sich aus und geht gleichzeitig damit gegen die auferlegten Schamgefühle vor: Es sind die falschen Dinge, die Quelle der Scham sind in dieser Welt, schreibt sie. Ich versuche, das Stigma aufzuheben durch meine Arbeit. Ich zeigte das Leben und den Tod meiner Freunde, das gab der Krise ein menschliches Gesicht.
Nan Goldin bemächtigt sich ihrer eigenen Geschichte und hält die Kamera auf Küsse wie auf Schläge. Sie zeigte nicht nur die schillernden Seiten der Queens, sie zeigte sie auch ungeschminkt, müde von der Arbeit am Küchentisch am nächsten Morgen, sie schwieg nicht zur AIDS-Krise, während sie die Schwulen und Lesben in New York in den Achtzigern zeigte, sie lichtete eigene Sexeskapaden ab, aber auch die Momente nach dem Akt, in denen der Riss der Entzweisamkeit nicht nur durch das zerwühlte Bett ging, sondern auch durch die entblößten Körper. Das alles macht Nan Goldin zur Chronistin ihrer Zeit. Der Schriftsteller James Baldwin sieht Kunstschaffende in der Rolle von Zeug_innen. Sie haben kein Urteil darüber abzugeben, was sie sehen. Sie müssen festhalten, was sie erleben und empfinden. Denn Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte später werden ihre Zeugnisse wahrhaftiger sein als die immer wieder umgeschriebenen Schul- und Geschichtsbücher.
Nan Goldin hatte nie Lust auf eine politische Agenda: We were never marginalized. We were the world …, sagt sie im Nachwort ihrer Ballade von der sexuellen Abhängigkeit.
Und tatsächlich hat sie es ganz ohne politische Theorie geschafft, die Ausgestoßenen einer Gesellschaft dieser Gesellschaft wieder nahezubringen.
Und doch möchte ich versuchen, zu verstehen, wie sie uns an ihrem Blick teilhaben lässt, ohne die von ihr abgelichtete Gewalt und Lust auszustellen. Dafür will ich über die Dramaturgie des “Weiblichen Blicks“ nachdenken, über das Aufweichen der Grenze zwischen Akteurinnen, Künstlerin und dem betrachtenden Auge.
Ich schlage also einen meiner Lieblingsbände auf, die Chronik I´LL BE YOUR MIRROR erschienen 1998. Sie dokumentiert über einen Zeitraum von 25 Jahren das Schaffen der Künstlerin. Die erste Doppelseite dieses Bandes füllt ein Selbstportrait aus dem Jahr 1980. Self-portrait in blue bathroom, London. Das türkise Blau der Wände, die abgeschnittene Badewanne links unten, darüber ein Spiegel, in dem ein weißer, durch die Jalousien des Fensters durchbrochener Lichtstrahl auf Nan Goldins nacktes Schlüsselbein und das Gesicht fällt. Ihre Locken sind ordentlich im Nacken zusammengebunden. Sie blickt neutral in den Spiegel, direkt in das Objektiv der nicht sichtbaren Kamera. Das Bild wirkt kühl und beruhigend, durch die Fluchtlinien der Badezimmerwände und die Entfernung zum Spiegel distanziert. Nan Goldin ist hier alterslos, ikonenhaft. Schlägt man die Seite um, steht die Fotografin, entstellt von Hämatomen, dicht vor dem Spiegel, mit ihrer Kamera vor dem Brustkorb, und drückt ab. Im Gegensatz zu ihrer makellosen Erscheinung im türkisblauen Badezimmer wirkt ihr Gesicht jetzt wie eine Maske. Eine Maske, die einem näherkommt als die unmaskierte Gestalt der vorherigen Seite. Ein altes Theatergesetz besagt, dass eine Maske demaskiert. Sie zeigt die Körperlichkeit deutlicher, verstärkt sie sogar.
Nur vier Jahre liegen zwischen Goldins porzellanhafter Erscheinung in einem blauen Badezimmer und der verwundeten Gestalt, die hier vor uns tritt als Self-portrait battered in hotel. Kaum auszuhalten, dass es dasselbe Gesicht ist, das uns anschaut. Die Künstlerin tritt sich selbst zu nah, rückt an den Spiegel heran, der sich wiederum in einem Spiegel auf ihrer rechten Seite spiegelt. Von allen Seiten kann die Protagonistin ihr „being battered“ betrachten. Sie schaut sich an. Wir schauen sie an. Die Komposition des Bildes ist beeindruckend: In dem Seitenspiegel scheint ihr Gesicht noch mehr Totenkopf zu sein als in der Frontalansicht, in der man die rot nachgezogenen Lippen erkennen kann, die ordentlich gezupften Augenbrauen. Ihre Haare stehen ab, ihre verfilzten Spitzen werden eins mit der gelben Sechzigerjahre-Tapete. Die Grundfarbe dieses Bildes ist ein kränkliches Gelb. Gelb ist die Lampe, gelb Goldins Gesicht, ihre Hände, das Tuch über dem Bett, die Tür. Weil die Protagonistin selbst unscharf ist, können wir den Blick nicht länger auf ihrem Gesicht ruhen lassen. Der Blick rutscht immer wieder aus, rutscht ab, rutscht in die Ecken dieses Hotelzimmers in Berlin. Er gerät ins Kreiseln. Goldin schreibt: – die Spirale. Ich bin besessen von der Spirale –
Trotz der tiefen Furchen in dem Gesicht und der zerzausten Haare erweckt sie kein Mitleid. Ihre Haltung ist keine gebeugte, eher eine suchende. Als wolle sie etwas verstehen. Nan Goldin scheint geschwächt, aber nicht gebrochen.
Immer wieder lande ich bei den geschminkten Lippen. Die Fotografin tat es oft, wenn sie sich „battered“ ablichtete: Sie schminkte sich, zog die Augenbrauen nach. Self-portrait battered in hotel ist nur eines der vielen Bilder, die sie, wie sie es nennt, „at her bottom“ zeigen. Und doch ist sie auf allen diesen Fotografien bereit für den Blick von außen.
In ihrem Essay „Visual Pleasure and Narrative Cinema“ aus dem Jahre 1975 definiert die Filmkritikerin Laura Mulvey den Male Gaze, den männlichen Blick, als die asymmetrische Machtverteilung zwischen den Geschlechtern. Kunst, erschaffen durch den Male Gaze, räumt einer Partei die Macht und die Deutungshoheit über das dargestellte Geschehen ein. Der Rest ist Statisterie und leistet die Zuarbeit für diese eine Machtposition, für die eine richtige Perspektive. Selbstverständlich war und ist diese On-Top-Position männlich. Als Antwort darauf entwickelt die Filmemacherin und Theoretikerin Jill Soloway das Konzept des Female Gaze als eine alternative Erzählstruktur, in der die_der Kunstschaffende nicht über das Objekt spricht, es bewertet, es ausstellt, auf ein Podest hebt oder es als nichtig entlarvt. Soloway spricht vom weiblichen Blick als einer Triangel an Zeichen, die sie in folgenden Schritten beschreibt:
-
Der Weibliche Blick ist eine subjektive Kamera, die das Sehen fühlt. Er richtet sich nie von außen auf die Protagonistinnen und Protagonisten, sondern erzählt von innen heraus.
-
Der Weibliche Blick zeigt, wie es ist, Objekt der Beobachtung zu sein. Die Kamera sagt uns: So fühlt es sich an, dass ihr mich anschaut.
-
Der Blick wird zurückgegeben. Die Botschaft lautet nicht nur: Ich bin mir bewusst, dass ihr mich beobachtet, sondern: Ich sehe euch.
Der Female Gaze ist ein Präventionsmittel gegen Voyeurismus. Er scheint mir der Schlüssel zum Verständnis von Nan Goldins Werk zu sein.
Durch das unerträgliche Licht wird keine Distanz zur Betrachterin gewahrt. Die soziale und die künstlerische Etikette werden nicht eingehalten. Wie ein Gesicht, das einem viel zu nahekommt und darum verschwimmt, kann ich die Protagonistin der Fotografien nicht mehr von mir abstrahieren. Ich weiß nicht, ob sie mir ins Ohr flüstert oder ob ich die eigene Stimme im Kopf höre. Ob es meine rot geschminkten Lippen sind, die sich der Kamera präsentieren. Ich bin mir der Präsenz der Kamera bewusst. Die Komposition des Bildes und meine Körperhaltung lassen keine Zweifel offen, dass ich mich im Zimmer vor dem Spiegel positioniert habe. Ich bin bereit für den Blick auf meinen Körper, mein Gesicht. Ich weiß, ich werde beobachtet, und ich weiß, das ist der Grund, warum wir hier sind.
Durch mich spricht die Kamera, und ich weiß nicht genau, was ich sehe. Der (weibliche) Körper, mein eigener Körper, entgleitet mir. Ich versuche zu verstehen, und gleichzeitig zeige ich: Es tut weh. Aber ich bitte um nichts. Ich bin Verletzte, aber ich bin kein Opfer. Meine Wunden sind sichtbar, aber nichts an meiner Mimik oder Gestik ist ein Hilferuf. Hier ist eine Frau, die der Welt etwas über sie verrät, indem sie ihre Blutergüsse in die Kamera hält.
Der Female Gaze verdankt seinen Namen dem Umstand, dass es einen Male Gaze gibt, gegen den er sich abhebt, doch gehört er nicht dem weiblichen Körper. So wie bestimmte Fertigkeiten und Charaktereigenschaften nicht dem einen oder anderen Geschlecht zugeteilt werden können, so kann auch der Female Gaze aus jedem Körper heraus entwickelt werden, betont Jill Soloway. Ich würde ihn den a-hierarchischen, den queeren Blick nennen. Es ist der zweifelnde Zugriff auf den Stoff, der die Aussage darüber verweigert, wer in der erzählten Geschichte recht behält.
Dieser Blick ist so alt wie die Menschheitsgeschichte, doch war seine Rolle immer marginal. Auch in der Fotografie gibt es nicht viele Zeugnisse dafür: Die aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts überlieferten Bilder von Julia Margaret Cameron gehören dazu, die erst ab ihrem fünfzigsten Lebensjahr fotografierte. Ebenso die Aufnahmen von Gertrud Käsebier, die 1902 Gründungsmitglied der New Yorker Photo Secession war. Doch weil diese den anderen Blick dokumentierenden Arbeiten so vereinzelt existieren, bleiben sie Fallbeispiele, statt die Norm zu sein. Sie verschwinden.
Nan Goldin widmete ihre Arbeit in Versailles dem Women´s March von 1789. Zusammen mit Hala Wardé arrangierte sie einen Gang aus dem Dunkel der Kanalisationen in das Licht der Gärten. Sie schreibt, sie wolle diesen Gang metaphorisch verstanden wissen, als women´s journey, es war ihre Intention, den Zuschauerinnen zunächst das Gefühl für Orientierung zu nehmen, sie sollten verloren gehen zwischen den noch in Betrieb befindlichen Rohrleitungen, sie sollten das Wasser, das durch sie hindurch rauscht, hören, sie sollten nicht aufhören zu marschieren. Vor einer Geräuschkulisse, entwickelt vom Soundwalk Kollektiv, hört man die Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin, die 1791 von Olympe de Gouges verfasst wurde. Unter der Terrorherrschaft Robespierres wurde sie guillotiniert.
Sogar die Franzosen, mit denen ich gesprochen habe, wussten nichts davon – nicht einmal die Kuratoren! Es zeigt, wie tief die Geschichte der Frauen vergraben ist. … Die sogenannten Revolutionäre und die Führer der Bewegung manifestierten ein Rechtssystem basierend auf männlicher Dominanz, die geholfen hat, das Vermächtnis der Misogynie fortzusetzen. Es gibt so viele Geschichten, die verloren gegangen sind.
I wanted to go underground to see what is hidden …
Wir hatten Nan Goldin verloren, und wir fanden sie wieder im Keller, wo sie sich wohler fühlte.
Weil es Künstlerinnen wie Nan Goldin gibt, kann man diese unsere Geschichten nicht auslöschen. Sie schreiben sich uns ein, schreiben sich uns unter die Haut, werden unvergesslich. Sie sind eine Stellungnahme, ein Eingriff, ein Hoffnungsträger.
Es gibt keine unbeteiligte Zeugenschaft, und es ist das Geschenk, dass Sie uns allen machen, Nan, dass wir uns Ihren kompromisslosen Blick zueigen machen dürfen. Dadurch werden wir selbst zu Zeugeninnen, sind involviert, und dieses Involviertsein hinterlässt für immer einen Fingerabdruck auf dem Schaufenster der Geschichte.
Weil es Künstler_innen wie Sie gibt, wird das Zeugnis von Menschen an den Marginalien nicht mehr so leicht verschwinden. Dieses Zeugnis wird anderen Mut machen, es wird an ihren Wänden kleben, sie werden wissen: Die alternative Erzählung von Welt hat es schon immer gegeben und wird es immer geben. Und sie werden ermutigt sein, mit ihrem ganz eigenen Blick auf die Welt zu dieser Erzählung beizutragen, so wie Sie mich damals ermutig haben, zurückzustarren. I did and I do stare back.