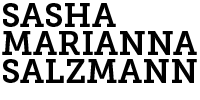KEINE JUDEN FÜR DIE AFD
Meine Freundin A. sagte einmal zu mir: „Meine Eltern können nichts dafür, dass sie furchtbare Menschen sind.“ Der Satz klingt jetzt wieder in meinen Ohren, während ich mir das diesjährige Integrationsbarometer des „Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration“ (SVR) vom September 2018 anschaue. Alle zwei Jahre misst der SVR mit dieser bundesweit repräsentativen Erhebung, wie es um das Integrationsklima in Deutschland steht. Dort kann man nun deutlich ablesen, wer der Behauptung: „Die aufgenommenen Flüchtlinge erhöhen die Kriminalität in Deutschland“, am häufigsten zustimmt: Wir. Beziehungsweise unsere Eltern. In keiner anderen Bevölkerungsgruppe ist die Zustimmung zur AfD größer als bei den „Spät-/Aussiedlerinnen und Spät-/Aussiedlern.“
Menschen wie A. und ich sind in den 1990er Jahren nach Deutschland gebracht worden, da waren wir Kinder, irgendwo zwischen zwei und Pubertät. In der Schule fragten uns die Lehrer, wer wir sind, und wir sagten: Wolgadeutsche, Deutschrussen, Russen, Ukrainer, Juden. (Damals natürlich ohne Gendering, denn wir waren weit davon entfernt, von Gendering auch nur gehört zu haben.) Die Lehrer selber nannten uns Kontingentflüchtlinge und Spätaussiedler. Unsere Mitschüler auf dem Schulhof nannten uns „Kontis“.
Wir sind keine homogene Gruppe, aber was wir alle gemeinsam haben, ist, dass unsere Eltern einen Neuanfang riskierten, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie waren damals so alt, wie wir jetzt sind, wir hatten keine Ahnung, was mit uns geschieht.
Der Versuch die Eltern zu verstehen
Nun sind wir Erwachsene und versuchen, zu verstehen, wie viel unsere Eltern für uns aufgaben. Wir sehen, dass sie sich dort nicht zu Hause fühlen, wo sie für uns eine Zukunft planten. Darum verzeihen wir ihnen bei unseren regelmäßigen Besuchen ihre reaktionären Bemerkungen. Wir wissen, dass sie aus politischen Systemen kommen, in denen nichtweiße Menschen wie selbstverständlich mit allen möglichen Tiernamen bedacht werden und wo die Überzeugung herrscht, die Gesellschaft brauche einen starken Mann, der sie führt. Dass der Feminismus eine Krankheit ist wie Homosexualität und sonstige Abarten des westlichen Lebens, Gendering zum Beispiel.
Diese unsere Eltern konsumieren immer noch Nachrichten aus ihren Herkunftsländern, die ihnen erzählen, was in dem Land, in dem sie nun leben, geschieht. Vor ein paar Jahren bekamen wir mit, dass einige von diesen unseren Eltern auf die Merkel-muss-weg-Demos gingen, und wir schauten weg. Aus Scham. Wir versuchten, sie zu rechtfertigen, und sagten, dass sie in Deutschland keinen Anschluss finden, dass Deutschland hart zu ihnen sei.
Um des Friedens in der Familie willen suchten wir nach Erklärungen dafür, dass sie auf „Flüchtlinge“ schimpfen und behaupten, dass man sich um die falschen Abgehängten kümmere. Um uns nicht gegen unsere Eltern zu stellen, gaben wir ihnen sogar manchmal recht. Aber nicht draußen in den Kneipen und in den Betten, wo wir uns trafen, um unser „westliches, liberales“ Leben zu feiern: zu vögeln, wen wir wollen, zu wählen, wie wir wollen. Wir haben versucht, nicht über unsere Eltern zu sprechen, weil es uns irrelevant erschien. Was sollten sie schon ausrichten? Sie waren die Pioniergeneration, wir sind die, die über die Zukunft von Deutschland entscheiden. Wir lagen falsch.
Wir sind über zwei Millionen
Unsere Eltern haben deutsche Pässe, sie gehen wählen. Noch vor ein paar Monaten redeten wir uns ein, die Meldung, es werde Juden in der AfD geben, sei ein Scherz des Satiremagazins Titanic. Auch wenn wir wussten, dass für viele unserer Eltern eine Gruppierung mit faschistoiden Tendenzen wählbar ist. Während sie ihre Stimme an den Urnen rechten Parteien geben, welche dieselben illiberalen Verhältnisse herstellen wollen, vor denen sie uns bewahren wollten, schauen wir zu. Unsere Eltern gehen nicht mehr vereinzelt auf schmuddelige Demos, sie machen eine relevante Wahlgruppe aus. Wir sind über zwei Millionen.
Das Erstarken der rechten Parteien hat etwas mit uns zu tun, und das bedeutet, dass wir etwas ausrichten können. Politik ist nichts, was einem passiert. Wir müssen nicht tatenlos zusehen, wie die AfD zweitstärkste Kraft in diesem Land wird. Das hier ist keine Historical Fiction auf Netflix.
Die Prognosen sind real, die nächste Wahl kommt, und sie wird auch unser Gesicht widerspiegeln. Das gilt nicht nur für uns „Kontis“, sondern auch für die, die uns damals auf dem Schulhof so nannten: Man kann nur bei denen etwas bewirken, die man liebt. Wir müssen an unsere Familien ran. Wir müssen widersprechen.
(Quelle: Gastbeitrag Spätaussiedler und AfD | taz im Oktober 2018 / taz.de)