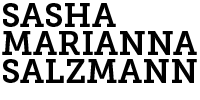Gemeint sein
Laudatio für Jens Hilje und Shermin Langhoff anlässlich des Preises der der Stiftung Preußische Seehandlung 2016
In der Kurzgeschichte „Vibrationshintergrund“ von Selim Özdogan beschreibt der Autor seine Begeisterung für die Wortneuschöpfungen, die dadurch zustande kommen, dass Kinder sich verhören. Er selber verstand als kleiner Junge statt „Zivilcourage“ „Zivilgarage“ und stellte sich darum eine Garage voller Polizisten in Zivil vor. Nun kommt in seiner Kurzgeschichte seine kleine Tochter zu ihm und sagt: „Papa, die Lehrerin in der Schule hat gesagt, ich habe einen Vibrationshintergrund. Was ist das?“
Die gesamte Kurzgeschichte über erklärt Özdogan der Tochter, dass Vibratoren etwas sind, was den Leuten Spaß macht. Sie sind ihnen aber auch peinlich, darum verstecken sie sie ganz weit hinten in der Schublade und holen sie dann heraus, wenn sie ihren Spaß haben wollen. Weiter in der Geschichte vergleicht Özdogan Migrant*innen mit Vibratoren und findet, dass seine Tochter den Punkt genau getroffen hat: Wir machen Spaß, wir sind ein bisschen peinlich, wir werden ausgepackt, wenn man uns braucht und – wir vibrieren.
Als ich die Anfrage bekam, diese Laudatio zu halten, war ich gerade in Selimiye an der Ägäis-Küste. Das ganze Dorf schien bewohnt von kommunistischen Aussteiger*innen aus Deutschland. Menschen, die in den 70er Jahren in die Bundesrepublik gekommen waren, um dort in den Fabriken Geld zu verdienen und sich im Alter eben genau diese Häuser an Meeresküsten zu kaufen, in denen ich sie heute besuchte. Die Bücherregale dieser Menschen stehen voll mit Karl Marx, Rosa Luxemburg und Nazim Hikmet. Und natürlich kannte man dort Shermin.
Der Mann, mit dem ich zu Abend aß, nachdem ich erfahren habe, dass Shermin und Jens den Preis der Preußischen Seehandlung erhalten, schlug mit der Handfläche auf den Tisch und schrie: „Die Shermin! Natürlich erinnere ich mich an sie! Das war die, die immer widersprechen musste. Bei jedem Treffen unseres Vereins stand sie auf und beschwerte sich über die Unterrepräsentation von Frauen im Vorstand und dass sie noch ein Mal über die Beschlüsse diskutieren möchte. Wirklich jedes Mal. Sie hat uns nichts durchgehen lassen, wenn es ihr nicht passte. Ich habe sie geliebt dafür.“ Dann nahm er einen kräftigen Schluck Raki und fragte mich: „Wie ist sie denn heute?“ Ich schaute ihn an, lächelte und musste nichts antworten. Wir hatten uns schon verstanden.
Ich habe Shermin 2008 kennengelernt. An einem frühen Abend, ich war noch an der Universität der Künste, wo ich Szenisches Schreiben studierte, bekam ich einen Anruf, in Kreuzberg sei so eine Theatereröffnung, ich soll mal hinkommen, vielleicht kann ich etwas darüber schreiben für unser Magazin freitext, in dem ich den Theaterteil redaktionierte. Hungrig und ungeduscht bin ich also in dieses kleine Hinterhoftheater in der Naunynstraße, glücklicherweise kannte mein Begleiter den Barman. Der fütterte uns mit einer Flasche Rotwein, so dass ich sehr, sehr glücklich im Zuschauer*innenraum sitzen und „Café Europa“ von Nuran David Calis schauen konnte. Und da passierte etwas in mir, von dem ich erst später verstanden habe, was es war. Ich weiß noch, dass ich mich damals einfach sehr wohl gefühlt habe und dann noch der Rotwein- aber wenn ich heute darüber nachdenke, was damals, an meinen ersten Abenden am Ballhaus Naunynstraße mit mir war, glaube ich, es war das Gefühl von Sichgemeintfühlen. Meine Lebensrealität auf der Bühne wiederzufinden, war neu für mich. So ein Gefühl kann man sich nicht antrinken.
Ich weiß noch, wie ich etliche Jahre vorher am Schauspielhaus Hannover, wo ich hospitierte, vom Dramaturgen von Johann Kresnik hören musste, die Figur des Woyzecks sei mit einem russischen Schauspieler besetzt worden, weil das Publikum ihn durch seine Andersartigkeit schnell als Fremdkörper wahrnahm. Als einen, der nicht reinpassen kann, selbst wenn er will. Ich hatte das gehört und dachte: So wird das immer sein. Ich nahm es hin, dass Leute wie ich dafür eingesetzt werden, das Fremde darzustellen, wenn man uns braucht. Ich dachte, das wäre normal. Und all das verschob sich plötzlich, als ich also aus dem Zuschauer*innenraum des Ballhaus Naunynstraße an die Bar stolperte. Die Premierenparty von „Café Europa“ begann und auch sie war irgendwie anders. Sie ähnelte den Parties, auf die ich nach den Theatervorstellungen abhaute, weil sie im Theater immer steif und gezwungen waren. Ich stand also am Tresen, und neben mir war diese schönen Frau, die ich nicht kannte, aber die mit mir ein Gespräch anfing, als würden wir uns seit Ewigkeiten kennen, als wären wir schon seit Jahren im Gespräch, und sie war nur kurz Getränke holen. Wir redeten über Sichtbarkeit als politischen Moment, über Repräsentation im Theater, über Vorbilder, die wir noch schaffen müssen, über Stücke, die noch geschrieben werden müssen, damit sie unsere Realität abbilden. Über Schauspielpraktiken.
Wir waren uns ziemlich schnell einig, dass Assimilierung tötet, dass wir aktiv sein müssen und die Revolution muss eine permanente sein. Klar – ich hatte mich sofort verliebt! Als die Frau dann tanzen ging, sagte mein Begleiter zu mir: Das ist übrigens die neue Intendantin hier. Shermin Langhoff. Da bin ich von meinem Barhocker gleich auf die Tanzfläche gekippt.
Jens Hillje begleitet mich ähnlich lange, fast länger sogar, nur dass ich es nicht wusste.
Natürlich habe ich schon während meines Studiums an der Universität Hildesheim den Namen Jens Hillje gehört. Was ich aber nicht wusste war, dass der Club hinter dem Hildesheimer Bahnhof, in dem ich jedes Wochenende tanzen ging, von diesem Jens Hillje eigenhändig zusammengezimmert worden war. Ich wusste nicht, dass dieser Jens Hillje, der von sich in Berlin reden machte, weil er zuerst die Baracke am Deutschen Theater zu einer Sensation machte, dann an der Schaubühne die deutsche Theaterlandschaft internationalisierte, auch in Hildesheim dasselbe studiert hatte, was ich studierte. Ich habe Jens im Ballhaus Naunynstraße auf einen der besagten, sehr bald legendären Parties kennengelernt und erst danach langsam verstanden, dass ich ihm einen großen Anteil meines Theaterdenkens verdanke. Und Löseke, den einzigen tollen Club in Hildesheim. Jens, danke dafür. Mit mir bedankt sich die gesamte Hildesheimer Student*innenschaft. Du weißt selber, das ist der einzige Ort, wohin ein junger Mensch in Hildesheim und Umgebung gehen kann, um eine gute Zeit zu haben.
Was eine Kommunistin mit Vibrationshintergrund und ein schwuler Anarcho-syndikalist heute für eine ganze Generation junger Theatermacher*innen bedeuten –
ich weiß nicht, wo ich anfangen würde, das zu erklären. Aber es geht hierbei nicht darum euren Werdegang zu rezitieren, dafür gibt es das Internet.
Ich erzähle euch, was es für mich ist:
Ich hätte nicht an der UdK Szenisches Schreiben zu Ende studiert. Ich wäre es irgendwann leid gewesen, als die Fremde eingekauft zu werden und wäre doch Bewährungshelferin geworden, wie das ursprünglich der Plan gewesen war. Ich hätte mich vom Theater abgewendet als einem elitären Ort, der nur um seiner selbst willen existiert. Ich wäre in einer politischen Extremist*innengruppe aufgegangen oder wäre doch Ärztin geworden. An dieser Stelle: Mama, sei Shermin und Jens nicht böse, aber sie sind der Grund, warum ich nie Ärztin werde. Weil ich glaube, dass das, was wir hier tun, auch retten und heilen kann. Ich hab´s gesehen.
Was wir tun? Theater. Ein Theater, das sich als Netzwerk versteht. Als eine Plattform für Versehrte, für die Ungehaltenen. Für die, die suchen. Für die, die niemals aufhören skeptisch zu sein. Für die, für die es nie eine Norm gegeben hat. Für die Fragezeichen, wie es vor kurzem über die Charaktere in meinem Stück „Meteoriten“ hieß. Für die, für die es nicht selbstverständlich ist, sich gemeint zu fühlen. Dieses „Sichgemeintfühlen“ kann einen aus der Resignation, Aggression und Verzweiflung retten, wenn man als junger Mensch sich darauf einstellt, immer der Fremdkörper in einem sonst intakten Organismus zu sein.
Der Trick des Teufels ist nämlich nicht, uns glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt. Der Trick des Teufels ist es, uns glauben zu lassen, dass wir alleine sind. Wir brauchen einander, um zu wissen, dass wir nicht verrückt, quer, exotisch sind und uns anzupassen haben, wenn wir überleben wollen oder eben dieses „Exotischsein“ ausstellen müssen, um weiterzukommen.
Ich habe mir die Begründung der Jury angeschaut und dann überlegt, wofür ich euch feiere. Dafür, dass ihr das, was ihr seid, in Praxis umsetzt. Es hat noch niemanden besser gemacht, zu einer marginalisierten Gruppe dazuzugehören. Es macht einen nicht weiser oder sprechberechtigter, Frau zu sein, Tscherkessin oder schwul. Man muss sein Wissen in Strukturen übersetzen, Zugänge schaffen. Sonst bleibt man Quote. Man bleibt Exot*in, im schlimmsten Fall ein Vorzeigeobjekt, damit sich die Mehrheit bestätigen kann, dass strukturelle Benachteiligung überwunden ist.
Eure Erfahrung, also ihr als Personen, ist am Gorki angewandte Praxis und keine Theorie. Und das ermutigt viele. Es lädt uns ein. Ihr habt euch nicht dem hingegeben zu sagen, „wer nicht in unser Theater kommt, will halt nicht“.
Erfahrungsgemäß kommen Leute, wenn sie sich eingeladen fühlen. Wenn Leute nicht kommen, dann nicht, weil sie nicht wollen. Wir alle wollen eingeladen werden. Gemeint sein. Ein- oder ausgeladen kann man sich am Theater fühlen durch die Gesichter auf den Plakaten, durch den Preis einer Eintrittskarte, durch Geschlechterzeichen auf den Toilettentüren, vor allem durch die Identifikation mit den Themen auf der Bühne.
Niemand will seine Lebenszeit und sein Geld in Abende investieren, in denen man selber verzerrt dargestellt wird oder gar nicht erst vorkommt. Ich weiß noch, wie du, Jens, dich mal über Rundfunkgebühren beschwert hast: „Die wollen, dass ich den vollen Preis zahle, dabei kommt meine Realität in den öffentlich-rechtlichen gar nicht vor!“ Und genau mit diesem Impetus, mit dieser Wut hast du mit Shermin zusammen die Verantwortung, Staatsgelder zu nehmen, umgewandelt in eine Einladung für alle. So weit es im Theaterkontext geht. Ihr habt euch die Mühe gemacht, die gesamte Stadt einzuladen, und die Stadt ist gekommen. Kreuzberg ist gekommen und säuft mit Charlottenburg zusammen in der Kantine in Berlin Mitte.
Shermin, Jens, wisst ihr noch, als wir den Look, die neue Corporate Identity dieses unsäglichen Sowjetischen Baus, den ihr da übernommen habt, diskutierten? Das Zitat von Maxim Gorki: „Es genügt nicht das Bestehende darzustellen, notwendig ist das Mögliche zu denken.“ Damals wollten wir „Das Mögliche denken“ als Schriftzug im Foyer installieren. Und kamen nicht dazu. Aber man muss es, glaube ich, nicht mehr an unsere Wände schreiben.
Es gab und gibt immer wieder Versuche, das Gorki als Phänomen zu beschreiben. Dann fallen so Begriffe wie „postmigrantisch“. Aber das Maxim Gorki Theater unter eurer Leitung ist kein postmigrantisches Haus. Es ist ein Haus im 21. Jahrhundert. Mit zeitgenössischen Lesarten von Klassikern von Tschechow bis Shakespeare, mit Festivals zum Armenischen Genozid, zum Arabischen Frühling, zu Flucht und Vertreibung. Mit Stoffen, die Geschlechterkonstruktionen herausfordern und mit echt guten Parties.
Gorki ist ein Prisma. Eine Metapher für ein Denkprinzip. Für Inklusion, die sexy ist und kein aufoktroyiertes Quotenprojekt. Es ist die Verpflichtung zum demokratischen Handeln.
Jens, Shermin, ihr Anarchos seid die größten Demokrat*innen, die ich kenne.
Ihr habt gesagt: Wir kriegen ein Stadttheater, also bilden wir die Stadt ab. Ihr habt genau geschaut, wer im Kulturbetrieb nicht oder nur als Dekoration vorkommt und habt nicht nur Stücke „für sie“ auf den Spielplan gesetzt, ihr habt die Leute auch noch in die Strukturen reingeholt.
Ich weiß noch, wie man damals spekulierte: Was soll dieses neue Gorki werden unter der neuen Leitung? Wilde Theorien entfalteten eine eigne Dynamik in den Theaterkantinen. Man schien sich in einer durational performance darauf einzuschwören, dass da in Berlin jetzt was passieren wird und man müsste irgendwas Verqueres sein, um mitmachen zu können.
Kolleg*innen, die keine Markierungen aufweisen konnten, aber bereits engagiert waren, bekamen nicht selten die Frage, was sie am Gorki zu suchen hätten. Ich glaube, da hörte ich zum ersten Mal den Vorwurf, dass Migrant*innen in Deutschland bevorzugt werden. Weil ich, seit ich mit Jens und Shermin zusammenarbeite, vergesse, dass ich
als Migrantin gelesen werde und dass meine und unsere Arbeit Minderheitenthemen sind. Das vergisst man, wenn man an einem solchen Ort wie dem Gorki arbeitet. Und dass sollte man auch vergessen. Sonst kann man kaum Kunst machen. Also ich kann es nicht.
Das Vertrauen, das ich als der Kopf von Conflict Zone Arts Asylum im Studio Я von euch damals bekommen habe, das Programm zu machen, für das ich einstehe, ohne Kontrollen – ich wusste erst im Nachhinein wie einmalig dieses Vertrauen war.
Ihr habt mir nicht reingeredet, als ich gesagt habe, im 21. Jahrhundert darf es in öffentlichen Institutionen keine Toiletten geben, die nur zwei Geschlechtern zugewiesen sind und die Mann/Frau-Zeichen runternahm. Ihr habt mit mir um Geld gekämpft, damit wir einen Fahrstuhl für Rollstuhlfahrer*innen für das Studio bekommen. (An dieser Stelle: Jürgen Maier, danke dir! Der erste und wahrscheinlich einzige Geschäftsführer, zu dem der Gang ins Büro mir gute Laune macht.)
Ihr habt uns Conflict Zone Arts Asylum machen lassen und kamt zu unseren Diskussionsveranstaltungen wie zu unseren Parties. Der Barman, der mich damals bei der Eröffnung vom Ballhaus Naunynstraße mit Rotwein abgefüllt hatte, wurde unser Barman im Studio Я und fütterte uns weiterhin mit Rotwein, weil wir nie zum Abendessen kamen.
Und es ist nicht so, dass wir uns nie streiten. Dass ich alle eure Entscheidungen mittrage, dass ich glaube, wir machen alles richtig und reiten in eine glorreiche Zukunft. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind ein ganz gewöhnlicher Stadttheaterbetrieb mit langsamen Mühlen und chronischer Unterbezahlung. Wir tippen uns die Finger blutig, diskutieren uns die Stimmen heiser, vernachlässigen unsere Partner*innen, schlafen viel zu wenig, rauchen viel zu viel. Aber mit euch habe ich nicht hinterfragt, ob es anders sein müsste. An jedem anderen Theater hätte ich das. An jedem anderen Theater wäre ich nicht. Ich wäre nicht hingegangen an Orte, wo man Menschen mit Vibrationshintergrund als Fremde besetzt. So wie damals in Kresniks Woyzeck.
Wenn ich also darüber nachdenke, was das Besondere an der Arbeit am Gorki ist und warum ich niemals irgendwo anders arbeiten will, dann ist es die Stimmung der Angstfreiheit, alles diskutieren und austragen zu können. Mit Angst sind die Wege der Marginalisierten geteert, wir bleiben in ihr stecken, fahren uns meistens fest und werden zu Säulen, zu Klischees. Wenn man sich nicht bewegt, wird man zur Karikatur seiner selbst und wiederholt immer wieder dasselbe Mantra darum, wie benachteiligt man ist. So wollte ich niemals sein.
Als Shermin mir erzählte, dass wir jetzt „Stadttheater gehen“, war ich skeptisch. Ich war schon länger skeptisch um das Abfeiern des Konzepts des „Postmigrantischen Theaters“ am Ballhaus Naunynstraße, das spätestens seit Nurkan Erpulats und Jens Hilljes „Verrücktem Blut“ bedeutete, dass Theatergänger*innen aus Charlottenburg mir meinen Rotwein an der Bar wegtranken und sich beschwerten, dass niemand auf ihre Mäntel an der Garderobe aufpasst. Ich war skeptisch, ob es sich hierbei nicht um einen Hype handelt, der uns, Vibratoren, wieder einmal benutzte für Eigenzwecke. „Verrücktes Blut“ wurde in der Rezeption jedenfalls katastrophal anders gelesen, als die Macher*innen es konzipiert haben. Und es nutzte nichts, dass sie nicht müde wurden, bei jeder Gelegenheit, ob beim Theatertreffen oder in Mülheim, zu erklären, dass es kein Stück darüber ist, wie migrantische Jugendliche „so seien“, sondern ein Stück über den rassistischen Blick auf sie. Ich hatte Angst, dass man uns instrumentalisiert a là: wenn sie es selber sagen, dann dürfen wir auch dazu klatschen.
Und ich kann nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der heutige Erfolg des Gorki nicht auch damit zu tun hat, dass wir für eine Beweisführung benutzt werden, zu der unsere Lebensrealität im konträren Widerspruch steht.
Es gibt noch lange keinen Austausch auf Augenhöhe, und so lange wir als Sex-Spielzeug von Debatte zu Debatte weitergereicht werden, werden wir das Dilemma um Vereinnahmung nicht überwinden. Aber ich habe gelernt, dass es wichtig ist, seine Arbeit zu machen und sich nicht zu sehr darum zu scheren, wer wen wie gerade für was verkauft. An Selbstbildern zu arbeiten geht, wenn man erst einmal die Möglichkeit hat, Selbstbilder zu entwerfen. Dafür braucht man Räume. Das Ballhaus Naunynstraße war so ein Raum. Heute ist es für mich das Gorki.
Ich kann im Gorki alles sein, was ich bin: Sasha, Marianna, queer, jüdisch, gender fluid, schlecht gelaunt, euphorisch, wütend, verzweifelt. Ich kann es sein, weil ich als das, was ich bin, ernst genommen werde. Weil ihr es mir abverlangt, etwas zu mir zu sagen. Stellung zu beziehen. Das, was ich will, zu erkämpfen und zu verteidigen. Ich glaube daran, dass sich Dinge bewegen, weil ich es sehen kann. Weil wir alle gemeinsam miteinander irgendwohin wollen. Wohin, wissen wir immer nur für den einen Tag und dann geht die Verhandlung wieder von vorne los.
Irgendwer hat mal gesagt, Heimat ist nicht der Ort, an dem du geboren bist, sondern die Zeit, in der du lebst. Shermin, Jens, ich habe dank euch eine verdammt gute Zeit. Und ich schätze, mit eurer Arbeit schafft ihr eine Heimat für ganz viele, die dieses Wort normalerweise nicht mal in den Mund genommen hätten.
Gorki heißt auf Russisch „bitter“. Das wisst ihr vielleicht. Der große Maxim gab sich dieses Pseudonym: der Bittere. Was ihr vielleicht nicht wisst: Gorki schreit man in Russland auf Hochzeiten. Man schreit Bitter! Bitter! Gorko! Gorko! Und dann müssen sich die Frischvermählten küssen. Wisst ihr noch, wie wir überlegt haben, aus der Gorki Eröffnung eine türkische Hochzeit zu inszenieren und Shermin in einem Brautkleid von Kreuzberg nach Mitte auf einem Pferd zu schicken und vor den Pforten würde Jens auf sie warten – ebenfalls im Brautkleid?
Ich halte nicht sehr viel von Ehen, aber ihr seid ein Grund, an Zusammenschlüsse zu glauben. An Allianzen, an einen Kampf, manchmal gegen einander, aber trotzdem für ein Gemeinsames. Weil es euch und eure Arbeit gibt, glauben so viele Menschen da draußen, dass sie nicht alleine sind. Dass sie gemeint sind. Das kann einem manchmal die Welt bedeuten.
Und weil ich im Gorki neben meiner Hausautorenschaft auch als Hochzeitsrabbi tätig bin, erkläre ich euch hiermit für das sexieste Brautpaar der Theaterszene. Ihr dürft euch jetzt küssen. Gorko! Gorko!
About: http://www.tagesspiegel.de/kultur/theaterpreis-berlin-die-good-vibrations-des-maxim-gorki-ensembles