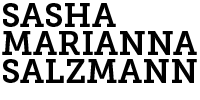Es gibt keine Gedichte über Krieg
Es gibt keine Gedichte über Krieg. Es gibt nur Zersetzung, heißt es bei der Dichterin Lyuba Yakimchuk. Also zerlegt sie die Wörter: Lu-hansk; Don-basssss; und zum Schluss des Gedichts ihren eigenen Namen: Nicht mehr Lyuba steht dort, sondern nur noch „ba!“. Wobei die Formulierung „zerlegt sie“ falsch ist, denn die Wörter, die Orte, die Menschen sind bereits zerlegt, Yakimchuk schreibt nur auf, was stattfindet. „Sprache ist so schön wie die Welt, die sie umgibt. Wenn jemand deine Welt zerstört, wird es die Sprache reflektieren“, sagt die in der Donezk-Region geborene Autorin. Sie versteht sich als literarische Nachfahrin von ukrainischen Futuristen wie Mykhailo Semenko, der die Dekonstruktion in die ukrainische Lyrik brachte und, wie so viele andere Dichterinnen und Dichter in den Jahren des Stalin-Terrors, erschossen wurde.
Es gibt keine Gedichte über Krieg. Nur Zersetzung. Ich habe in den letzten Monaten versucht zu schreiben. Nicht über den Krieg. Einfach nur zu schreiben. Zwischen Telefonaten auf der Suche nach Wohnungen für Menschen, die fliehen. Auf der Suche nach Medikamenten, aufblasbaren Matratzen, Kinderschuhen, Badesachen, den passenden SIM-Karten. Ich hing in der Warteschleife des Bürgeramts, weil über die Hotline für Ukrainische Flüchtlinge niemand erreichbar war und ich also immer und immer wieder weitergeleitet wurde. Eine verlangsamte Version von „The Sunsilk Girl“ zersägte mir das Ohr, während ich auf das leere Blatt auf dem Desktop meines Laptops starrte und dachte, in der Zeit, in der ich warte, könnte ich doch ein paar Zeilen schreiben. Als sich schließlich, nach knapp zwei Stunden Warten, Fragen und Weitergeleitet-Werden, ein Beamter verplapperte und sagte: „Hören Sie, ich kann Sie weiterverbinden, aber die Kollegen haben die Anweisung, es klingeln zu lassen“, legte ich auf. Ich starrte wieder auf das leere Blatt vor mir. Jetzt, genau jetzt, könnte ich doch etwas schreiben.
Mit Valeria war ich in den Wochen seit ihrer Flucht viel im Austausch – wir gingen zusammen zur ärztlichen Untersuchung ihres achtjährigen Kindes, wir saßen zusammen über Anmeldeformularen, aber auch in Parks, aßen Croissants aus Papiertüten und redeten über die schöne Stadt Kiew, in die sie nicht allzu lang vor der Kriegserweiterung aus dem Osten des Landes gezogen war. Valeria sagte, die vielen Stunden auf den Ämtern bringen ihr durchaus etwas, sie lerne Deutsch. Ihren ersten Satz könne sie schon: „Bitte warten Sie.“
Es gibt keine Gedichte über Krieg. Ich habe versucht, ein paar Zeilen zu verfassen, in der Bahn, auf dem Weg zu Tatjana. In den ersten Wochen der Belagerung von Mariupol hatte sie den Kontakt zu ihrer Mutter verloren, dann, nach sechzehn Tagen Funkstille, kam das erste Lebenszeichen. Man habe die Mutter wiedergefunden: Sie war zu Fuß durch das Kriegsgebiet über die Grenze nach Russland geflohen. Aus Mariupol war sie nach Rostow am Don gegangen. Es seien zu Fuß 36 Stunden (180 km), sagt mir Google Maps. Wenn man ohne Pausen geht und wenn kein Krieg herrscht. Tatjanas Mutter ist dreiundsiebzig. Die Russen hätten sie am Aufnahmestützpunkt hilfsbereit empfangen, nur eine Frage sei ihr seltsam vorgekommen: „Haben Sie auf dem Weg irgendwelche Verbrechen gesehen?“ Dann gaben sie ihr Tee und setzten sie in einen Evakuierungsbus Richtung Moskau. Tatjanas Mutter hat es über Vilnius und Warschau nach Deutschland geschafft, nun sitzt sie bei Tatjana in der Wohnung und erzählt, die Ukrainer hätten sie und ihr Haus beschossen. Die Ukrainer hätten Bomben auf sie geworfen, Raketen auf sie abgefeuert, ihren Garten zerstört. Es waren nicht die Russen, es waren die Ukrainer, sie weiß es, so war es im Radio durchgesagt worden.
Die Oberfläche des Wassers in Tatjanas Glas zitterte. „Aber weißt du“, schob sie nach, „ich kann mir ja noch auf die Zunge beißen, aber wie soll Rita ruhig bleiben?“ Rita ist Tatjanas ältere Schwester. Sie war eine Woche vor ihrer Mutter aus Saporischschja geflohen, sie musste ihren Sohn und ihren Mann zurücklassen, die sich der Stadtverteidigung angeschlossen hatten.
So sitzen die beiden Schwestern Tag für Tag vor ihrer dreiundsiebzigjährigen Mutter, die zu Fuß über halb zerstörte Brücken und verminte Felder gegangen war und jetzt ihren Töchtern erklärt, die Russen wollten Frieden…