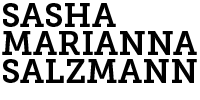Dankesrede anlässlich des Kleistpreises
…
Mit der Dichterin M saß ich dieses Jahr für meinen Großvater Shiva. Genaugenommen war es eine sowjetische (oder zumindest meine sowjetische) Version des jüdischen Brauchs des Trauer-Sitzens: Wir tranken Rotwein auf dem Balkon, aßen Butterbrote, fluchten, und ich erzählte, wie Danja, mein Großvater, vom Schrecken über den 7. Oktober 2023 niedergestreckt worden war. Drei Schlaganfälle nach dem Massaker der Hamas, danach konnte und wollte er nicht mehr. Ein Jahr lang begleitete ich meinen Großvater bei seiner Achterbahnfahrt durch die Erinnerung an sein Leben und damit durch ein knappes Jahrhundert.
Als Kind überlebte er den Krieg, weil er im Wald giftige Beeren von essbaren unterscheiden konnte, nach dem Krieg ist er nicht erfroren, weil er die Schalen von Sonnenblumenkernen im Ofen verheizte. Berge von Schalen, weich und durchscheinend wie Schmetterlingsflügel. Die Schalen verbrannten schnell, aber er holte sie mehrmals am Tag in großen Säcken und erinnerte sich noch knapp vor seinem Tod an das Scheuern des Jutestoffs auf seinem Kinderrücken. Mein Großvater überlebte die Wehrmacht, überlebte Stalin, überlebte die Sowjetunion. Im Westen dann, in Niedersachsen der 90er Jahre, musste er mit ansehen, wie Neonazis sein Enkelkind durch die Straßen jagten, während sich das vergangenheitsbewältigte Deutschland zur eigenen Beruhigung Nie Wieder vorsagte. Er erlebte die Wahlerfolge von rechtsradikalen Parteien. Er erlebte die Kriegsausweitung in der Ukraine. Dem Land, in dem er seine Frau kennengelernt hatte. Dem Land, in dem seine Eltern und Großeltern begraben sind.
Nie werde ich sein violett verfärbtes Gesicht vergessen, als er die Forderungen hörte nach dem, was hierzulande „Frieden mit Russland“ genannt wird. Was quasi bedeutet: „Gebt die Ukraine auf. Es ist eure Geschichte, nicht unsere. Ergebt euch! Und eure Städte, eure Museen und eure Gotteshäuser werden nicht länger zerstört werden. Gebt eure Frauen, eure Mütter, eure Söhne, eure Brüder auf.“ Es ist nicht unser Krieg – wie oft habe ich diese Wandschmiererei seit Februar 2022 gelesen? Wie wirksam das Gift der Verdrängung sein muss, dachte ich. Der Wunsch nach Unschuld brennt einem die Augen aus. Hohl blicken die Schädel in eine leere Vergangenheit, die keine Fäden zieht zu dem, was jetzt geschieht.
Das von Schlaganfällen geschüttelte Hirn meines Großvaters nahm noch wahr, dass nach dem 7. Oktober jüdische Friedhöfe geschändet wurden, er wusste von dem brennenden Thoraschrein in Wien. Von den Davidsternen, die an Türen geschmiert wurden, hinter denen man jüdische Menschen vermutete. Immer wieder fragte er nach den in den Tunneln festgehaltenen Geiseln. Und wieder hörte er (und hörte ich) das deutsche Mantra vom Nie Wieder, während längst faschistische Parteien die Wahlsieger stellen und Stolpersteine aus dem Boden gerissen werden. Menschen werden durch die Straßen gejagt. Und Schuld daran sind immer die Anderen. Um der eigenen Verzweiflung in der Brust Platz zu schaffen, macht man sie ausfindig unter den Schwächeren, unter denen, die man am Rand wähnt.
Dieses Bild wird mir für immer bleiben: die schweren Stiefel der Polizisten, die Gedenkkerzen für die Opfer in Gaza austreten, unweit meiner Wohnung am Hermannplatz. Die verstörten Gesichter der Trauernden. Mir geht nicht aus dem Kopf, wie bei Demonstrationen gegen Rechts, gegen die Vision einer ethnisch gesäuberten Gesellschaft, Mitdemonstrierende, die eine Kufiya um die Schultern trugen, bespuckt wurden.
Wohin verrutscht die Seele eines Menschen, wenn er so etwas tut?
Ich denke über diese zwei Wörter nach: Nie wieder. Es ist eine Forderung, die sich auf die Zeit, auf ein jeweiliges Heute bezieht. Dieses unser Heute gilt für alle, nicht nur für einige, nicht nur für eine Minderheit. Wer sich die Toten der Anderen wegdenken möchte, wer Menschen aus der gemeinsam geteilten Zeit wirft und sie damit der gemeinsam geteilten Welt verweist, beschädigt das Gedenken an die Shoah.
Eine palästinensische Autorin berichtete dieses Jahr von einem Umstand, der mir bekannt vorkam: Sie beschrieb, wie sie von Redakteur*innen unterschiedlicher Medien immer wieder gerügt wurde für den Versuch zu beschreiben, wie es ist, wenn einem in der deutschen Öffentlichkeit der Raum zum Sprechen genommen wird. Die Rüge stellte nicht ihre Beobachtungen in Frage, sondern ihr Rederecht: „Du kannst das nicht sagen. Du brauchst einen Juden, der das für dich schreibt.“
Ich kenne diese Reaktion, ich lebe hier schon lange. Ein Jude hat eine sehr spezifische Sprecherrolle – im Deutschen Theater. Nun, was für eine Erleichterung, Schriftsteller*in zu sein. Denn wir Schreibenden gehören keinen Nationen, keinen Religionen. Wir gehören ihnen an. Aber wir gehören ihnen nicht.
Dichtung ist eine eigene Sprache, wir schreiben nicht in Nationalsprachen. Dichtung, wenn sie gelingt, ist von Ideologien frei. Die Rolle der Dichtenden ist es, außerhalb der Gesellschaft zu stehen und sie zu beäugen. Wir verweigern uns dem Dienst am Staat. Was für eine Befreiung, unberechenbar zu sein und damit unbrauchbar. Wir Schreibenden (Künstler*innen überhaupt) sind ein eigenes Volk. Und ich fordere für uns alle – ohne Ausnahmen – Rederecht.
…
Vollständige Rede hier