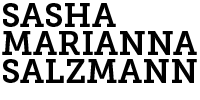Angst nicht so romantisch
Sexual Preferences: No blacks, no arabs, no asians. Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Postcolonialism and Queerness erzählte einer der Panelist*innen über seine Rassismuserfahrungen auf schwulen Portalen wie GayRomeo und Grinder. Seine Conclusio aus den Anekdoten über Männer, die ihn aufgrund von seiner Hautfarbe abgelehnt haben, war: Hey, I do not wanna police desires. If they don´t like it, they don´t.
Das hat mich verblüfft. Heißt das, das Begehren steht außerhalb von uns, von den Strukturen, in denen wir uns bewegen? Ist Begehren etwas Unantastbares, Indiskutables, vielleicht gerade deswegen so aufregend, weil nicht moralischen Normen unterzogen, weil nicht pc?
Vielleicht sind unsere Gefühle das letzte Große, woran wir glauben wollen. Gott, Karma, Kommunismus stehen momentan nicht hoch im Kurs. Jedenfalls in den links-liberalen Kreisen, in denen wir, Theaterschaffende, uns gerne glauben. (Es scheint ein Naturgesetzt zu sein: Wer am Theater arbeitet ist links. Was auch immer darunter zu verstehen ist.) Aber Gefühle – Gefühle sind das, was noch bleibt. Wo wäre das Theater ohne Gefühle, wie hat Brecht sich das genau vorgestellt mit dem nicht romantisch glotzen, wie denn sonst? Wir postulieren unser individuelles Empfinden verschaffen uns damit Gehör. Ich, der Mensch, empfinde. In dieser Taktilität bin ich verwundbar, fehlbar somit glaubwürdig und sympathisch.
Viel besprochen war der Fernsehauftritt der Bundeskanzlerin in der ARD-Wahlarena als sie auf die Frage, ob sie sich für oder gegen Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare ausspricht, antwortete: „ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwer tue“. Sie erfuhr reichlich Sympathie für diese „Ehrlichkeit“, denn sie würde auf ihr Bauchgefühl hören, so der Kanon in Blogs und Kommentaren. Da haben ganz viele sie romantisch angeglotzt, weil sie sich damit vermeintlich als menschlich outete.
In der Zeit, in der alles sachlich klärbar zu sein scheint, ist das persönliche Befinden die letzte Bastion. Liebe, Begehren, Angst – wer wären wir, wenn sie erklärbar, gar entschlüsselbar wären? Wenn sie kein Geheimnis wären, sondern profane Kausalitätsketten: Ich habe diesen Grießbrei als Kind gern gegessen, immer wenn ich ihn wieder esse, denke ich Heimat. Als Kind habe ich in der Schule „Angst vor dem Schwarzen Mann“ gespielt – heute habe ich Angst vor dem „Schwarzen Mann“. Wir sind sauer, wenn man uns unsere Gefühle erklären möchte. Wir wollen ein Anrecht auf ihre Besonderheit. Weil sie sich besonders anfühlen, müssen sie wahr sein. Etwas mehr erzählen als die Summe der Ereignisse, etwas Tieferes, Wahrhaftigeres. Sich auf der richtigen Seite wähnend, scheint es uns legitim zu sein, sich über die Eindimensionalität der Diskurse der ausgemachten Feindgruppen von Bär- über L- bis Pegida lustig zu machen. Und wie sieht es mit unseren eigenen Diskursen aus?
Durch die Theaterwelt geht gerade – Mal wieder – eine Aktionismuswelle. Man müsse was tun gegen die Neonazis, die AfD, für die Flüchtlinge, für Toleranz, Vielfalt etc. Ich glaube nicht, dass es geht, ohne sich selber mitreinzunehmen in die Analyse, was eigentlich faul ist in diesem Staate.
„Die Ängste der Mitbürger*innen ernst nehmen“ – diese Forderung, schicken CSU Politiker aufgrund von fehlendem Geschichtsbewusstsein in die Welt, aber machen wir, Kulturschaffenden, das nicht auch, gekonnt verpackt in einen Spielplan? Gibt es für uns nicht auch die Prämisse des Fremden und der Gefahr, die von ihm ausgeht, von der aus wir dann darüber diskutieren, wie viele von diesen Anderen eine sich auf ein nationales Gefühl eingeschaukelte Gemeinschaft verträgt? Wie spielen wir mit den „Ängsten“ unseres Publikums, was wird da alles reproduziert?
Angefangen bei der Performance in den Intendanzfluren über die Personalbesetzung der Gewerke und den Umgang unter den Geschlechtern erzählen wir unsere Haltung zur Welt. Und diese spiegelt sich dann in dem wieder, was abends in diese Welt zurückgegeben wird, wenn der Vorhang aufgeht.
Wenn wir um Toleranz bitten mit aufklärerischen Stücken aus dem 18Jahrhundert, wenn wir dunkelhaarige Schauspieler*innen suchen für dieses eine Projekt über Neukölln, wenn wir sagen, ich würde ja gern eine schwarze Julia besetzen, aber das Publikum wird da was ganz anderes reininterpretieren… Der Begriff der Toleranz impliziert, dass es eine Norm gibt, von welcher aus man toleriert. Das geht erst ein Mal darüber, dass man sich als Norm begreift, um dann das a-normale auszumachen, um es dann wiederum in das eigene Raster integrieren zu wollen (Assimilation) oder die Botschaft zu senden, du bist anders, aber ich kann trotzdem mit dir leben (Toleranz). Wir setzen Normen fest. Nicht zuletzt wir Kunstschaffenden.
Natürlich kann es nicht darum gehen die „Angst“ von solchen Gruppen wie Pegida und AfD ernst zu nehmen („Hass“ wäre sicherlich das richtigere Wort hier oder „Wohlstandschauvinismus“). Aber man muss Angst dekonstruieren, um zu verstehen, wie sie gemacht wird. Damit sie nicht so ein Mysterium bleibt und damit ein unantastbares Gefühl. Was ist mit unserer eigenen Angst? Wir machen vielseitige Spielpläne, haben in unseren Ensembles auch Mal Schauspieler*innen mit Migrationshintergrund. Aber tut der Platzhalter Pegida nicht auch gut, um sich nicht damit zu beschäftigen, dass wir selbst ein Teil der Dynamik sind?
Wenn jemand hochschwanger plötzlich Angst empfindet gegenüber dem Flüchtlingsheim in seiner Nähe, ist es dann rassistisch oder ein natürlicher Instinkt? Wenn jemand seine Handtasche fester an sich drückt, wenn Romafrauen vorbeigehen, wenn die Kinder nicht mehr im Park spielen sollen, weil da gedealt wird, weil ein Kind auf eine Schule gehen soll, wo deutsch gesprochen wird usw. usw. usw. Können wir uns aus diesen Ängsten abstrahieren?
Es ist sicherlich müheloser über Nathan der Weise nachzudenken als darüber, dass Menschen mit zu dem Mehrheitsdiskurs alternativen Biografien nach wie vor ein Exotenmoment in der deutschen Theaterlandschaft sind. Und warum das so ist. Das merkt man nicht zuletzt bei Kommentaren a lá, jetzt beschwert euch nicht, ihr habt doch jetzt das Maxim Gorki Theater.
Žižek sagt: „The problem for us is not, that our desires are satisfied or not. (…) there is nothing natural about our desire. (…) and movies tell us how to desire.“
Žižeks Zitat weitergesponnen für den Begriff der Angst könnte heißen: movies, media and my grandmother tell me how to fear and whom to fear. Filme kriegen uns mit ihren ästhetischen Bildern (die böse Latino-Clique verängstigt die blonde Frau, aber der obligatorische blonde Held ist nicht weit – hey, fanden wir nicht alle „Drive“ total schön gemacht?). Medien beeindrucken mit guten Schnitten (eindringlich schnell Kausalitätsketten bildenden Nachrichtenvideos, bei denen die Moderator*innen von Terror sprechen, während man Muslime beten sieht). Und dann noch die eigene Großmutter. Haben wir nicht alle diese eine Großmutter, die uns vor der bösen Welt da draußen beschützt hat, uns auf ihren Schoß genommen hat, wenn wir mit aufgeschürften Knien heulend vom Spielplatz kamen, uns getröstet, in ihrem Armen gewogen und dabei „Zehn Kleine N*“ gesungen? Nein? Dann vielleicht „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“, während sie uns zum Fasching ein „Indianerkostüm“ genäht hat?
Und es tut gut, Ängste zu haben. „The problem for us is not, that our desires are satisfied or not…“ Wenn man etwas hat, wogegen man seine Angst richtet (die bettelnde syrische Familie, die dealenden Jungs im Park, der Staat Israel etc.), dann weiß man, wer man ist. Angst ist ein verbindendes Moment. Sie schafft Einigkeit, Einheit. Sie vereint uns zu einer Gemeinschaft, sie vereint uns mit unserer Großmutter, sie wirkt identitätsstiftend. Anders kann ich mir die Vehemenz nicht erklären, mit der hierzulande gegen das Ersetzen des N* Wortes in Kinderbüchern oder Blackfacing gekämpft wurde. Als wäre Kunst geschichtsfrei, als hätten wir Rassismus überwunden – oder zumindest bei Pegida & Co. gelassen.
An unseren Gefühlen ist nichts natürlich. Sie sind gemacht. Es klingt verletzend. Aber unsere Ängste müssen benannt und entzaubert werden. Wir müssen aufhören um Toleranz zu bitten, sondern eine neue Selbstverständlichkeit entwickeln, die nicht mehr auf wir und ihr basiert. Sonst sind unsere Theaterdiskurse im Kern nicht weit von denen, die wir so haarsträubend finden.
Wenn unsere Angst gemacht ist, dann tragen wir Verantwortung. Und wenn wir sie auseinanderpflücken, um zu sehen, wovon wir geprägt sind, dann haben wir eine Chance. Das Ziel muss doch sein, unserer Angst nicht mehr so ausgeliefert zu sein, von ihr überrascht und überrumpelt zu werden, um am Ende zu verzweifeln, sich zu schämen und gar nichts zu tun. Das Ziel muss doch sein, eine gerechtere Gesellschaft zu behaupten und zu leben, als wäre das Theater die kleinste Zelle dieser Utopie.
Erschienen der Theater der Zeit, Heft 11/2015